Liebe Leser*innen, liebe Autor*innen, heute möchte ich hier, nicht nur wegen der aktuellen Debatte um Peter Handke, den Nobelpreisträger, dessen Erzählung »Wunschloses Unglück« vorstellen. Das Buch ist 1972 bei Suhrkamp erschienen. Zur Neuauflage nach 30 Jahren schwärmt Ulrich Greiner: Dass Peter Handke (geboren 1942) zu den großen Dichtern gehört, daran gibt es schon deshalb keinen Zweifel, weil er Wunschloses Unglück geschrieben hat, eines seiner innigsten und wahrhaftigsten Bücher. DIE ZEIT vom 2. August 2012
Im November 1971 hatte Handkes Mutter Selbstmord begangen. Sieben Wochen später versucht Handke in seiner Erzählung »diesen Freitod (…) zu einem Fall zu machen.« Er schreibt das Buch in wenigen Monaten.
Autofiktion oder Biografie
Nun könnte man einwenden, dass das Buch nicht in diese Reihe über autobiographisches Schreiben gehört. Es handelt sich doch wohl eher um ein biographisches und nicht um ein autobiographisches oder autofiktionales Buch. Das ist richtig. Und er erzählt nicht nur von seiner Mutter, sondern von der Lebenswirklichkeit einer ganzen Frauengeneration. Aber natürlich beschreibt Handke, indem er das Leben seiner Mutter beschreibt, auch sich selbst mit.
Und nicht nur als der Sohn, der mit der Mutter aufgewachsen, sich von ihr gelöst und eine enge Beziehung zu ihr hatte, sondern auch als der Schriftsteller. Der Schriftsteller, der sich an die Arbeit macht und dieses Buch schreibt.
Ja, an die Arbeit machen: denn das Bedürfnis, etwas über meine Mutter zu schreiben, so unvermittelt es sich auch manchmal noch einstellt, ist andrerseits wieder so unbestimmt, daß eine Arbeitsanstrengung nötig sein wird, schreibt er auf den ersten Seiten des Buches, auf denen er das Bedürfnis, über die Mutter zu schreiben, erläutert.
Dabei reflektiert Handke die unterschiedlichen Modi, in denen er schreibt. Diese ändern sich je nachdem, ob er über jemand dritten, in diesem Fall seine Mutter, oder sich selbst, den Schriftsteller schreibt. Offensichtlich kann er von dem schreibenden Ich in der Erzählung Abstand nehmen. Ihn gleichsam von außen aus der Vogelperspektive beschreiben. Beschreibt er eine real existierende Person, wie seine Mutter, ist das Gegenteil der Fall. Der Abstand wird immer kleiner und er versucht, sich sozusagen in die Figur hineinzuschreiben.
Nähe und Distanz
Im Buch gibt es einen längeren – in Klammern gesetzten – Einschub, in dem Handke diese unterschiedlichen Schreibverhältnisse erläutert.
Er möchte den Freitod seiner Mutter zum Fall machen, der für andere, von Bedeutung sein könnten. Daher sieht er sich veranlasst, erzählerische Distanz aufzubauen. Denn, so schreibt er in dem Einschub, aber nur die von meiner Mutter als einer möglicherweise einmaligen Hauptperson in einer vielleicht einzigartigen Geschichte ausdrücklich absehenden Verallgemeinerungen können jemanden außer mich selber betreffen ‒ die bloße Nacherzählung eines wechselnden Lebenslaufs mit plötzlichem Ende wäre nichts als eine Zumutung.
Gleichzeitig sieht er die Gefahr, dass die eigentliche Person, um die es geht hinter den Abstraktionen verschwindet. Wirklich nur noch zum Fall wird. Ihm ist bewusst, das Gefährliche bei diesen Abstraktionen und Formulierungen freilich ist, daß sie dazu neigen, sich selbständig zu machen. Sie vergessen dann die Person, von der sie ausgegangen sind ‒ eine Kettenreaktion von Wendungen und Sätzen wie Bilder im Traum, ein Literatur-Ritual, in dem ein individuelles Leben nur noch als Anlaß funktioniert.
Er sieht zwei Gefahren, einmal das bloße Nacherzählen, dann das schmerzlose Verschwinden einer Person in poetischen Sätzen.
Das gelte zwar für jede literarische Beschäftigung, besonders aber in diesem Fall, wo die Tatsachen so übermächtig sind, daß es kaum etwas zum Ausdenken gibt.
Tatsache und Beschreibung
Hier geht es nicht um Erfinden und Übertreiben wie bei Stanišić, sondern darum, das labile Gleichgewicht zwischen Tatsache und Beschreibung, zwischen Ereignis und Darstellung des Ereignisses nicht zu verlieren.
Anfangs ging ich deswegen auch noch von den Tatsachen aus und suchte nach Formulierungen für sie. Dann merkte ich, daß ich mich auf der Suche nach Formulierungen schon von den Tatsachen entfernte.
Aus der Psychoanalyse ist bekannt, dass sich ein Subjekt an einer Linie der Fiktion entlang konstruiert. Daher liegt es nahe diese Linie der Fiktion zu (er)finden, wenn man im Erzählen einem Menschen gerecht werden will.
Handke versucht es mit bereits verfügbaren Formulierungen, dem gesamtgesellschaftlichen Sprachfundus. Statt von den Tatsachen auszugehen, sortiert er, wie er schreibt: aus dem Leben meiner Mutter die Vorkommnisse, die in diesen Formeln schon vorgesehen waren; denn nur in einer nicht-gesuchten, öffentlichen Sprache könnte es gelingen, unter all den nichtssagenden Lebensdaten die nach einer Veröffentlichung schreienden herauszufinden.
Der Formelvorrat für eine Biographie
Die Herausforderung liegt nun für Handke darin, durch die nicht-gesuchten, öffentlichen Sprache das Individuelle und Besondere der Mutter durchscheinen zu lassen.
Ich vergleiche also den allgemeinen Formelvorrat für die Biographie eines Frauenlebens satzweise mit dem besonderen Leben meiner Mutter; aus den Übereinstimmungen und Widersprüchlichkeiten ergibt sich dann die eigentliche Schreibtätigkeit. Wichtig ist nur, daß ich keine bloßen Zitate hinschreibe; die Sätze, auch wenn sie wie zitiert aussehen, dürfen in keinem Moment vergessen lassen, daß sie von jemand, zumindest für mich, Besonderem handeln ‒ und nur dann, mit dem persönlichen, meinetwegen privaten Anlaß ganz fest und behutsam im Mittelpunkt, kämen sie mir auch brauchbar vor.
In den nächsten Abschnitten dieses Einschubs, reflektiert Handke den Unterschied zwischen dem autobiographischen und dem biographischen Schreiben. Hier mit sich selbst als der Hauptperson, auf der anderen Seite mit einer anderen Person, in diesem Fall seiner Mutter.
Der Autor als Kunstfigur
Interessanterweise gelingt ihm, wie er schreibt, normalerweise die Objektivierung der eigenen Person, des schreibenden Autors. Er wechselt dann vom beschreibenden Autor zum Beschriebenen. Entfernt sich aus seiner Innenwelt und betrachtet sich von außen. Bei seiner Mutter gelingt ihm das nicht.
Eine andere Eigenart dieser Geschichte: ich entferne mich nicht, wie es sonst in der Regel passiert, von Satz zu Satz mehr aus dem Innenleben der beschriebenen Gestalten und betrachte sie am Ende befreit und in heiterer Feierstimmung von außen, als endlich eingekapselte Insekten ‒ sondern versuche mich mit gleichbleibendem starren Ernst an jemanden heranzuschreiben, den ich doch mit keinem Satz ganz fassen kann, so daß ich immer wieder neu anfangen muß und nicht zu der üblichen abgeklärten Vogelperspektive komme.
Sonst gehe ich nämlich von mir selber und dem eigenen Kram aus, löse mich mit dem fortschreitenden Schreibvorgang immer mehr davon und lasse schließlich mich und den Kram fahren, als Arbeitsprodukt und Warenangebot ‒ dieses Mal aber, da ich nur der Beschreibende bin, nicht aber auch die Rolle des Beschriebenen annehmen kann, gelingt mir das Distanznehmen nicht. Nur von mir kann ich mich distanzieren, meine Mutter wird und wird nicht, wie ich sonst mir selber, zu einer beschwingten und in sich schwingenden, mehr und mehr heiteren Kunstfigur. Sie läßt sich nicht einkapseln, bleibt unfaßlich, die Sätze stürzen in etwas Dunklem ab und liegen durcheinander auf dem Papier.
Die Beschreibung des Unbeschreiblichen.
Während wir im Alltagsbewusstsein die Wirklichkeit oft in einer zeitlichen Abfolge von Ursachen und Wirkungen erleben (wollen), steckt für Handke genau dort die Fiktion. Um der äußersten Sprachlosigkeit, in der sich Handke durch den Suizid immer wieder findet, zu begegnen, fingiert er eine kausale, temporale Abfolge von Ereignissen. Und in dieser Diskrepanz scheint sogar etwas Komisches auf.
»Etwas Unnennbares«, heißt es oft in Geschichten, oder: »Etwas Unbeschreibliches«, und ich halte das meistens für faule Ausreden; doch diese Geschichte hat es nun wirklich mit Namenlosem zu tun, mit sprachlosen Schrecksekunden. Sie handelt von Momenten, in denen das Bewußtsein vor Grausen einen Ruck macht; von Schreckzuständen, so kurz, daß die Sprache für sie immer zu spät kommt; von Traumvorgängen, so gräßlich, daß man sie leibhaftig als Würmer im Bewußtsein erlebt.
Höchstens im Traumleben wird die Geschichte meiner Mutter kurzzeitig faßbar: weil dabei ihre Gefühle so körperlich werden, daß ich diese als Doppelgänger erlebe und mit ihnen identisch bin; aber das sind gerade die schon erwähnten Momente, wo das äußerste Mitteilungsbedürfnis mit der äußersten Sprachlosigkeit zusammentrifft. Deswegen fingiert man die Ordentlichkeit eines üblichen Lebenslaufschemas, indem man schreibt: »Damals ‒ später«, »Weil ‒ obwohl«, »war ‒ wurde ‒ wurde nichts« und hofft, dadurch der Schreckensseligkeit Herr zu werden. Das ist dann vielleicht das Komische an der Geschichte.)
Indem Handke diese Momente der äußersten Sprachlosigkeit zu formulieren versucht – schafft er Welt durch Sprache.
So gesehen kann er behaupten er käme von Tolstoi, Homer, Cervantes. Manch ein Autor heute kommt von Handke, vielleicht auch, ohne es zu merken.
Peter Handke, Peter Handke, Peter Handke



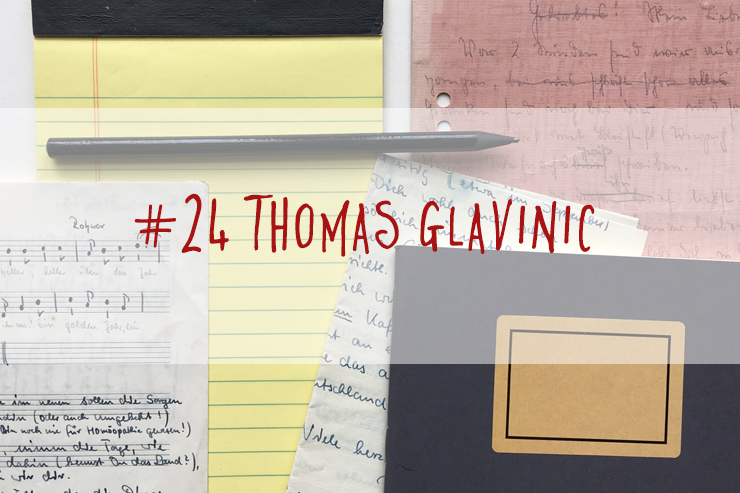
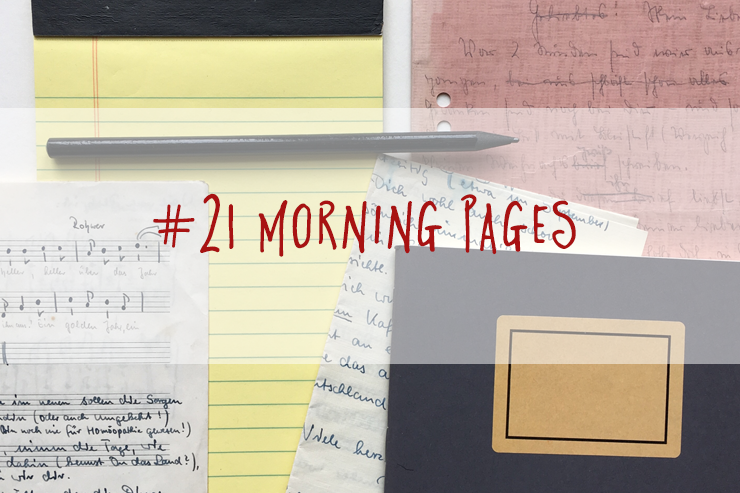
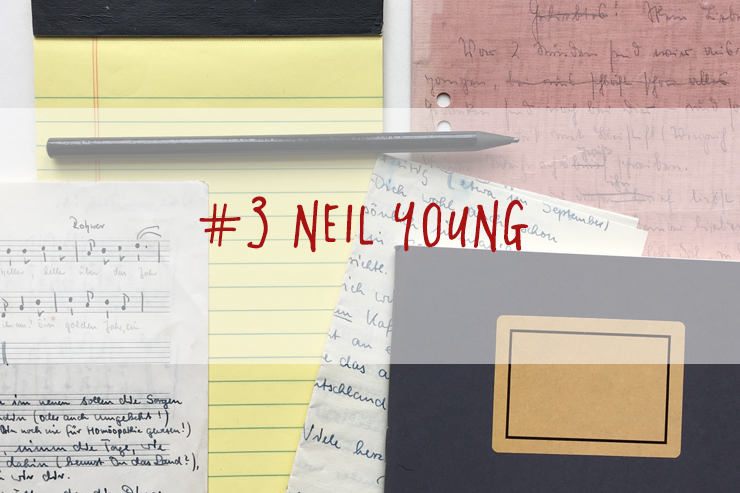
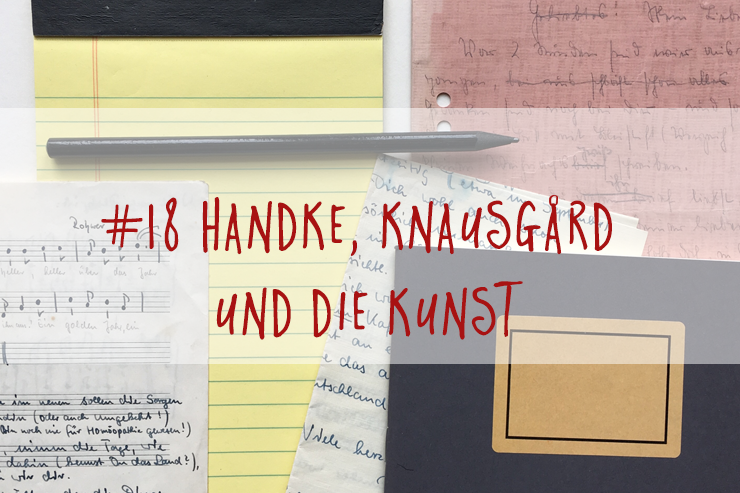
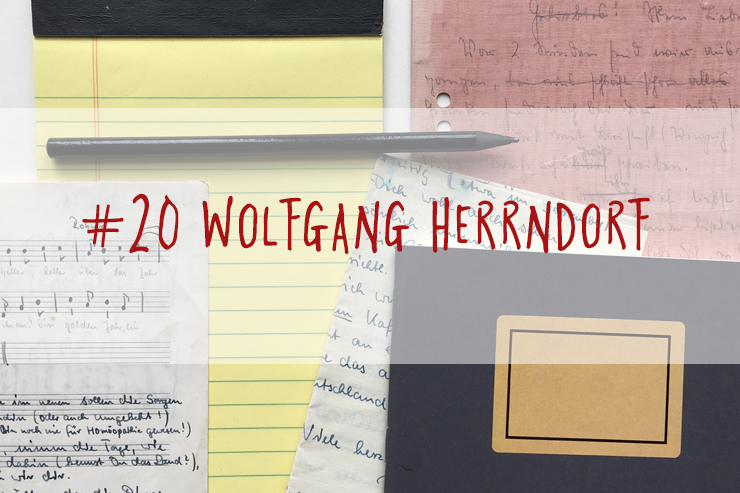
1 Comment