
Nach einem Jahr mit Beiträgen über autofiktionales Schreiben beginne ich heute eine neue Blogreihe. An jedem zweiten Mittwoch veröffentliche ich hier Ausschnitte aus einem autofiktionalen Work in Progress mit dem Arbeitstitel: Künstler ohne Werk.
Dabei geht es um einen Bildhauer. Um mich.
Im Prozess des Erinnerns, des Erzählens, des Wiedererzählens, des Aufschreibens, des Überarbeitens entsteht Erinnerung neu. Jedesmal. Genauso wie im Vergessen, Verdrängen, Auslassen, Streichen, Verschieben, Verdichten, Übertreiben und Erfinden. So kann, hoffe ich, in den verdichteten Texten eine neue bisher unbekannte »Wahrheit« zum Vorschein kommen.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt. Den Anfang macht eine Episode aus den frühen 80er Jahren: Randale
Künstler ohne Werk
#1 Randale
— 1981
Blau.
Schwarzer Nebel zieht über das Blau. Schwärzt es allmählich ein. Ein Motorradhelm. Jemand besprüht einen blauen Jethelm mit schwarzem Lack. Das bin ich. Ich probiere eine schwarze Lederjacke an. Erbstück vom Opa.
… and once you’re gone
you can never come back
when you’re out of the blue
and into the black.
dtschu, dtschu, dtschu,
dtschu, dtschu, dtschu …
In der Küche sitzen vier, fünf Leute an einem großen unaufgeräumten Tisch. Kaffee aus großen Bechern. Bierflaschen. Die meisten noch im Pullover, ein zwei Leute schon in schwarz. Stefan noch in Bluse und Rock.
—Ich komm nach, muss mich noch chic machen.
—Ja, da sollen heute viele fesche Jungs kommen. In Uniform.
—Ha,ha

Hape verdreht die Augen. Schießt mit seiner Knallpistole auf ihn.
Allgemeiner Aufbruch.
Im Hausflur nehmen die anderen ihre Helme von den Wandhaken. Neben der Haustür in einer Wandnische hängt locker aufgerollter Natodraht. Man weiß ja nie. Am Sonntag soll ein Pfarrer im Gottesdienst gefragt haben, ob es in der Gemeinde nicht genug starke Männer gäbe, um mit dem Zirkus, mit uns, aufzuräumen.
Natürlich sind alle da. Sitzen vor dem Haus. Lederjacken, Helme. Auf dem Bürgersteig, auf den Treppenstufen, im Eingang. Was können wir verhindern. Nichts. Nicht im Ernst. Aber protestieren. Da sein. Solidarisch. Uns wegtragen lassen. Es ihnen nicht ganz so einfach machen. Wieder soll geräumt werden. In den Fenstern sitzen Leute. Jubel. Gestresst. Transparente. Lautsprecher in den Fenstern. Punk. Das ist unser Haus. Passanten wechseln die Strassenseite. Stefan taucht auf, chic in schwarz. Geht ins Haus.
Es wird dunkel. Die Wannen rollen an. Blaulicht. Quer auf der Fahrbahn. Riegeln die Straße ab. Die nächsten fahren direkt auf den Bürgersteig. Auf uns zu. Wir bleiben sitzen. Sie bleiben in den Wagen.
Über Lautsprecher. Kommandos —Machen sie den Gehweg frei. Verlassen sie das Haus. Lösen sie die Versammlung auf. Begeben Sie sich nach Hause. Gegröle. Musik. — Wir werden Zwangsmassnahmen ergreifen.
—Wir auch. Haha. Plötzlich sitzen sie ab. Rennen los. Sie sind da. SEK. Weiße Helme, Schilde.
Sie versuchen erst gar nicht, uns wegzutragen. Gleich prasseln Stöcke. Ich laufe ihnen entgegen. Seid ihr bescheuert. Hört auf damit. Aber wir tauschen hier keine Wimpel aus. Das ist nicht Fussball. Schläge von vorn auf die Schultern. Seitlich gegen den Helm. Auf den Kopf. Zwischen die Beine, in die Seite. Ich dreh mich weg. Wieder auf die Schultern, auf den Rücken. An den Helm. Auf den Helm. Mehrere gleichzeitig. Wieviele sind das? Ich sehe nichts mehr? Der Helm fliegt ab. Ich reiße die Arme hoch. Sie schlagen nicht mehr auf den Kopf. Sie schlagen nicht mehr auf den Kopf. Sie schlagen nicht mehr auf den Kopf. Auf die Schultern. In die Nieren. Gott sei Dank, nicht auf den Kopf. Danke. Ich stolpere. Rolle mich unter ein parkendes Auto. Sie reißen an meinem Bein. Aber ich schaffe es. Bin unter dem Wagen. Ruhe. Wo ist der Helm? Ist das Blut? Nur vom Knie. Blaulicht, Geschrei. Flaschen fliegen.
Ich bleibe unter dem Auto, das siebte Geißlein. Dann robbe ich auf die Straßenseite. Habe genug. Ich kann laufen. Gehe ganz ruhig an den Wannen vorbei. Niemand beachtet mich. Der Bürgersteig ist leer. Die Musik in den Fenstern aus. Das Haus ist leer.
Sechs Leute sind in Gewahrsam genommen. Landfriedensbruch. Zwei im Krankenhaus. Ein Schlüsselbeinbruch, ein Nasenbeinbruch.
Eine Anklage wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Ausgerechnet für Stefan. Stefan, der sanfteste Mensch von allen. Der im Haus nur in Kleidern herumläuft, hatte sich für die Aktion eine Jeans unter den Rock gezogen und sich eine Lederjacke geborgt. Auf die Pumps hat er trotzdem nicht verzichtet und beißt einem Bullen in die Hand. Ich weiß nicht mehr, zu was sie ihn verdonnert haben.
Das kann man überleben. Ist also gar nicht so schlimm. Was man so aushalten kann.
Vor unserer Haustür haben sie eine Plakatwand aufgestellt. Das Haus steht schon lange leer. Jemand hat eine Tür reingesägt. Scharniere angebracht. Dahinter die Haustür. Es wird immer wieder brav neu plakatiert. Dann mit dem Cutter die Tür wieder aufschneiden. Jetzt steige ich durch den Marlboro Mann über drei Treppenstufen ins Haus.
Trever kläfft mich an. Wann wird der Hund endlich merken, dass ich dazugehöre, auch wenn ich hier nicht wohne. Ich habe hier mein Atelier.
Ich drehe den Lötbrenner auf schmelze Teer. Von Keilrahmen geschnittene alte Leinwände sind an die Wand genagelt. Mit Wandfarbe übermalt. Die Fenster sind auf. Mit dem breiten Pinsel. Ein diagonales Kreuz, wo das Gesicht wäre. Vermummt, darüber halbrund ein Helm. Diagonalen für die hochgeschlagenen Kragen. Den Brustkorb. Ein Arm hängt locker herunter, etwas Schweres in der Hand. Ein Kreuz.
Ein Bild nach dem anderen. Alle ähnlich, alle anders. Alle gleich. Die fertigen lege ich auf den Boden. Nagele neue an. Zehn stück, zwanzig. Ich weiß, ich habe etwas gefunden. Eine Form. Das ist es, was ich meine. Das sind wir. Wir sehen alle gleich aus. Die Bullen und wir. Keine Gesichter, keine Menschen, keine Individuen. Keine Sprache. Alle gleich. Helme, Vermummung, Jacken. Wir lassen uns auf ihr Spiel ein. Es ist ihr Spiel. Ist es ein Spiel? Kein Freundschaftsspiel. Alles schwarz, schwarz wie Teer.
— Sehr düster.
Sie sitzt hinter mir, anscheinend schon länger. Unsere Holländerin. Ich kenne sie kaum, sie heißt irgendwas mit E. wie Evelyn, aber viel komplizierter. Evangelina? Nein. Engeline. Genau, Engeline wie Angel. Und so sieht sie auch aus. Alles weiß. Weiße Haare, weißer Tüll, weiße Sandalen. Weiße Röcke oder Stoffe oder was auch immer sie umflattert.
— Warst du dabei? Ich hab dich nicht gesehen?
— Am Anfang. Ich war im Haus. Bin gegangen, bevor es losging. Du siehst doch, dass es nicht gut ist. Du malst es doch.
— …
— Sie werden uns auch hier rausholen.
— Ich weiß.
Ich mache mit ein Bier auf. Sie will keins.
— Aber solange sind wir hier. Willst du hierbleiben?
— Ich geh nach Berlin.
— Ich meine heute Nacht.
Ihr Zimmer ist genau wie sie. Das Gegenteil von Teer. Wir müssen durch Bernhards Zimmer. Der Boden vollständig mit einer dicken Torfschicht bedeckt. Waldschrat. Das macht es schwierig, die weißgestrichenen Dielen nicht zu verdrecken. Und ich bin nicht sicher, ob meine Strümpfe sauberer sind als die Stiefel.
Überall Tüll, an den Wänden, Gardinen, weiße Decken auf dem Tischchen. Ein Kleiderschrank ohne Tür, weißgetüncht, mit weißen Kleidern und ein Himmelbett.
— Ich mach uns einen Tee.
Sie geht in die Küche, wieder über den Torf. Runter in den ersten Stock.
Ich bleibe als schwarzer Klumpen in ihrem Zimmer. Setze mich auf den Boden. Versuche, mich nicht anzulehnen. Lege mich. Als sie wiederkommt, weckt sie mich. Sie hat sogar weiße Becher gefunden.
Meine schwarzen Klamotten liegen in einem Haufen vor ihrem Bett. Wir halten uns, beide verletzt. Irgendwann muss eine Kerze umgefallen sein. Wir werden rechtzeitig wach. Das Feuer ist schnell aus.







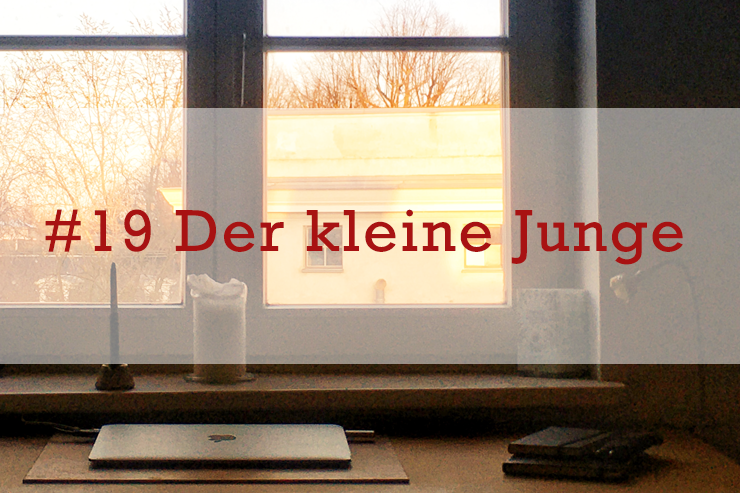
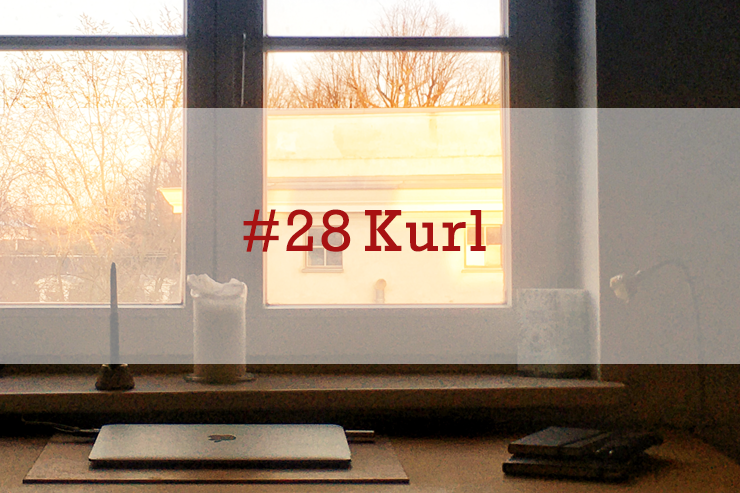


23 Comments