Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#9 Kreuzberg
—1984
36, tiefstes Kreuzberg.
Ende der freien Welt. Schlesisches Tor. Pfuelstraße. Das ehemalige Lagerhaus an der Spree ist jetzt mein Zuhause. Ist es das? Ich fahre durch die Durchfahrt, gleich zum Lastenfahrstuhl auf der Rückseite im Innenhof. Werde die XT mit hochnehmen in die Etage. Seit Dijon ölt der Motor. Wer wird wohl da sein? Ich freue mich auf niemanden, habe keine Lust irgendjemand zu erzählen, wie es war. Ins Bett. Augen zu. Schlafen. Einfach die Zeit wegschlafen, bis sie wieder da ist. Wo wird mein Bett stehen?
Fahrstuhl ist nicht. Ich schiebe die XT mit laufendem Motor die Treppe rauf. Jede Stufe mit ein bisschen Gas. So geht es, trotz Gepäck.
Hinter der schweren Stahltür steht der Duft von Dope und Knoblauch. Es sind also Leute da und jemand hat sogar gekocht.
Freut mich das? Ja, ich habe Hunger.
Aber erstmal steige ich auf und fahre die dreißig Meter zu meinem Atelier, oder besser in den Bereich, der mein Atelier ist.
Das Bett steht noch. Genauso da, wie ich es verlassen habe. Es hat anscheinend niemand benutzt. Sieht so aus, als hätte sich niemand in meine Ecke getraut. Die angefangenen Bilder erinnern mich daran, wie dringend ich losgefahren bin. Wie froh, wie aufgeregt, wie voller Erwartung. Das ist nur gut eine Woche her. Dabei war ich voll in der Arbeit. Die Farbe ist in den Schüsseln eingetrocknet. Egal.
Und — nein. Scheiße nochmal. Es war wirklich niemand in meiner Ecke, oder zumindest hat sich niemand für meine Sachen verantwortlich gefühlt. Das zentimeterdicke Eis, das letzte Woche noch die Scheiben überzogen hat, ist bei den ersten Frühlingsstrahlen der letzten Tage von den Fenstern geschmolzen. Alle meine Mappen und aufgerollten Zeichnungen, die darunter lagen, sind aufgeweicht. Scheiße. Scheiße, Scheiße.
Bin ich ein Idiot, ihr nachgefahren zu sein. Nein, das war gut. Hör doch auf.
Ich reiße die dicke Folie zur Seite, die den Küchenbereich vom Rest der Etage trennt. Der einzige Teil, der mit einem Industrieofen, den K. besorgt hat, geheizt werden kann. Knapp hundertfünfzig Quadratmeter von etwas über tausend.
Sieht aus, als wären knapp ein Dutzend Leute da, essen gerade, schauen sich um, haben natürlich längst gehört, dass ich komme. Wenn Micha wieder sein: Nicht in der Etage mit dem Moped loslässt, haue ich ihm eine rein.
»Konnte nicht einer mal meine Sachen beiseite räumen, als es wärmer wurde?«
»Hä, wo wars’n du?«
»Mann du hast selbst gesagt, dein Atelier ist off limits. Remember?«
»Aber mal ein bisschen mitdenken? Zuviel verlangt? Da ist alles nass.«
»Jetzt mach nicht gleich wieder so einen Stress. Komm iss was, ist noch massenhaft Bolognese da. Und Rotwein. Und nicht in der Etage mit dem Moped.«
Damals hätte ich doch schon merken müssen, dass das keine Perspektive hat. Mit offenen Augen liege ich auf meiner Matratze, die Kapuze des Hoodies ins Gesicht gezogen. Außerhalb der Küche ist es immer noch scheißkalt. Das Bettzeug ist klamm. Immerhin habe ich die Mauer im Rücken, die ich quer zur Fensterwand aus geklauten Kalksandsteinen hochgezogen habe. Eigentlich zum Malen, um die Leinwände daran aufzuhängen. Jetzt ist es ein kleiner Schutz. Zwei Wände machen zwar keinen Raum, aber immerhin eine Ecke. Eine Erinnerung an Geborgenheit. Hoffentlich sind hier bald alle weg, die hier nicht hingehören. Jedes Mal, wenn die Stahltür zum Treppenhaus aufgeht, dieser Stress, wer kommt rein. Wer bringt noch wen mit? In welchem Zustand? Wenn das nicht wäre …
Und natürlich kommt K. nicht. Sie ist in Frankreich. Sie ist in Frankreich. Sie ist in Frankreich. Sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo vor einem Bistro in der lauen Nachtluft und ich starre in die Luft. Sehe meinem Atem nach. Die Fenstersprossen werfen im gelben Licht der Straßenlaternen Schatten an die gewölbte Decke da oben. Massenhaft Kreuze. Ein Kriegsgräberfeld.
Wie kriege ich nur geregelt, mit K. so eng zu bleiben und in einer so großen, offenen Etage zu leben, in einer so großen Gruppe?
Jetzt fange ich also auch an nachzudenken. In Frankreich war das alles so weit weg. Diese Enge in dieser Weite hier. Ohne Wände muss der Abstand einfach größer sein. Man hört alles, man sieht alles und man riecht eigentlich auch alles, was hier passiert. Überall Betten, Lager, Einkaufswagen mit Klamotten, aus denen man sich nimmt, was passt. Natürlich sind die besten Teile immer weg. Vermutlich doch irgendwo weggebunkert. Ich lege meine Motorradklamotten und meinen Maloverall ja auch nicht da rein. Zwanzig Zentimeter von jemand anderem entfernt kann man völlig allein sein. Wenn eine Wand dazwischen ist. Hier hört man jeden husten, schnarchen, vögeln.
Ich starre weiter auf den Soldatenfriedhof an der Decke. Zwei Tage lang bin ich beinahe die gleiche Strecke zurückgefahren, die die deutsche Truppen in Belgien verwüstet haben. Erst 1914 und dann nochmal 1940 auf dem Vormarsch auf Paris. Ich reiße mich von dem Anblick in meinem Kopf los. Von den gefallenen Soldaten, die zu sechst unter so einem Kreuz liegen und ihre Geliebte nie wieder gesehen haben. Nie wieder. Nicht so wie ich, eine Woche nicht. Nie wieder. Und sie haben das sicher auch vorher schon gewusst oder geahnt, egal ob sie fanatisch, verblendet oder gezwungen waren. Haben ihnen die Kinder auch zugewinkt, wie mir auf meiner knallenden XT. Nichtsahnend.
Zum ersten mal sehe ich die Decke als das, was sie ist. Gemauerte Tonnengewölbe, die auf Stahlträgern ruhen. Die Decke besteht aus preußischen Kappen. Dass sie so heißen und in Berlin wegen ihre hohen Stabilität im 19. Jhd. ständig für Kellerdecken und Decken in Fabriketagen genutzt wurde, weiß ich da noch nicht. Ich werde ja erst in sechs, sieben Jahren in der Denkmalpflege arbeiten.
Aber, yes! Das ist es! Das ist jetzt die Lösung. Ich könnte mir eine Bulliladung Gerüststangen von einer Baustelle organisieren und uns ein hängendes Bett, ein hängendes Wohnplateau an die Stahlträger der Decke schweißen.
Einfach über dem Ganzen schweben, wenn wir für uns sein wollen. Abstand in die Höhe.
***
Wow, was für eine Woche.
So ein Glück. In der Lausitzer wird gebaut. Gerüsttangen, Bohlen und Kupplungsklemmen ohne Ende. Nicht-mit-dem-Moped-in-der-Etage-Micha ist dabei. Ich liebe ihn. Bei all seiner ruhigen Besonnenheit, ist er doch draufgängerisch, mutig und immer Kumpel. Immer dabei. Fährt den Bulli an den Bauzaun, steht Schmiere, während ich eine Stange nach der anderen einlade. Mit möglichst wenig Geschepper. Der Bulli ist Gold wert. Wir kriegen sogar noch ein Dutzend Bohlen mit einer einzigen Wagenladung abtransportiert.
Jetzt Schweißen. Micha wieder dabei. Er reicht mir die Stangen hoch. Hält sie in der richtigen Position. Süß, wie er die Augen zusammenkneift, den Kopf wegdreht aus Angst vor dem grellen Lichtbogen. Aus berechtigter Angst. Hilft mir mein Bett zu bauen. Warum macht der das? Mein Liebesnest. Hab ihn noch nie mit einem Mädchen gesehen. Viel zu schüchtern. Aber ist er überhaupt schüchtern? Mir gegenüber nicht. Und ich weiß, dass er Recht hat. Ich sollte nicht in der Etage Motorrad fahren. Ich fühle mich von ihm durchschaut. Ich kann ihm nichts vormachen. Und es ist ein angenehmes Gefühl. Erleichternd.
Durch den Schweißspiegel sehe ich das Metall der Stahlträger und der Gerüststangen im Lichtbogen ineinander schmelzen. Gibt es ein besseres und gleichzeitig verheerenderes Bild für unsere Liebe, die alles verbrennt, wie die Hitze dieses Lichtbogens. Wir lösen uns auf, fließen ineinander und kommen nicht mehr voneinander los. Wollen wir das? Will ich das? Will sie das? Denkt sie darüber nach?
Micha reicht mir den Schraubenschlüssel hoch. »Wieso bist du eigentlich nicht mit Anne zusammengeblieben?«
Was ist das jetzt für eine Frage.
»Na ihr wart für uns alle das Traumpaar in den Häusern.«
»Ist einfach nicht so gut gelaufen.«

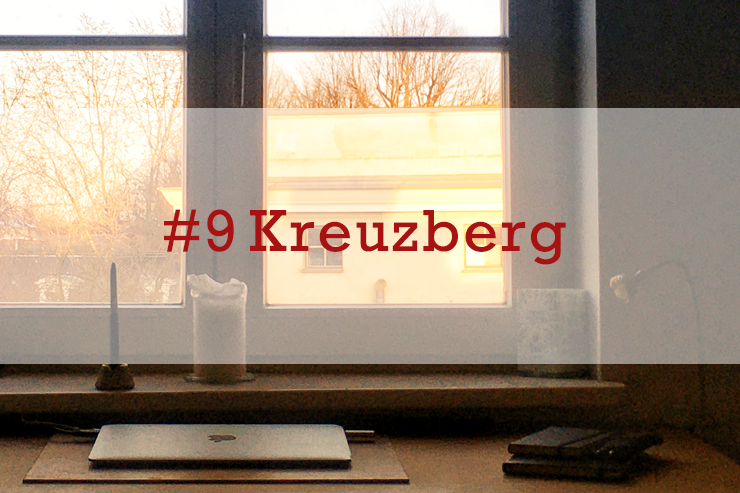


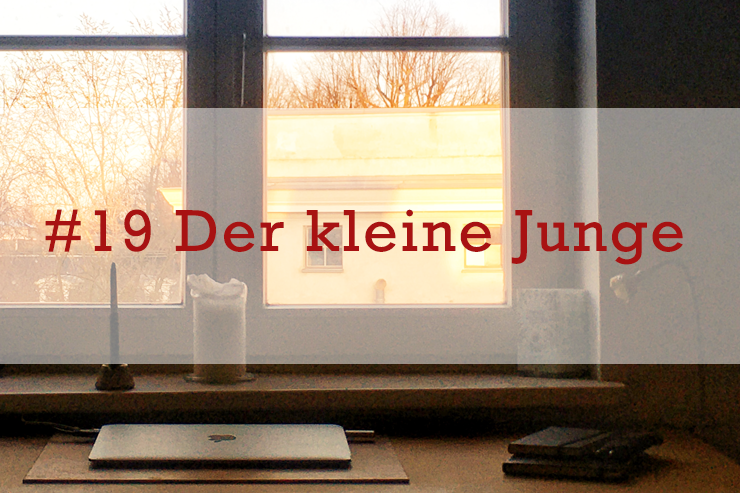
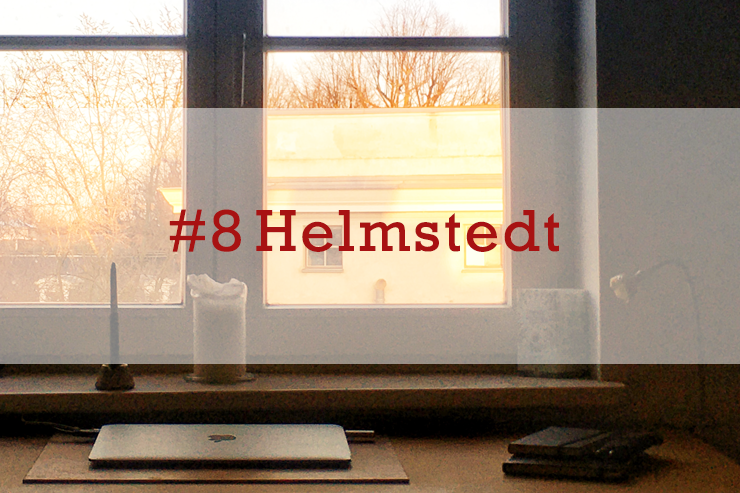

18 Comments