Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#15 Steh auf und geh
— 1988
Am nächsten Tag sitze ich wieder in der Jebenstraße. Ein neuer Versuch. Freue mich sogar. Fühle mich aufgeräumt und ruhig. Erinnere mich, wie viel Energie ich im Studium hatte über den Büchern. Wie oft ich der Letzte war, der abends aus dem Lesesaal geworfen wurde.
Erinnere mich an meine Wissbegierde.
Nehme mir nur eine kurze Passage vor, suche nur die Antwort auf eine kleine Minifrage.
Komm, das schaffe ich.
Das macht sogar Spaß.
Ja ich bin einer von ihnen. Gehöre zu ihnen, den richtigen Studenten, Lesern, Wissenschaftlern, Forschern, und ja auch zu dem nach kaltem Tabak riechenden Rentner in seinem verschlissenen Anzug. Ich liebe sie, die Entschlossenen, die Fokussierten. Die Brillanten und die Mittelmäßigen.
Und da liegen sie dann wieder, die Bücher.
Und etwas schießt ein in die weiche Stelle, wo der Kopf auf der Wirbelsäule aufsitzt. In den Hirnstamm. Alles was in Schläfennähe, hinter der Stirn oder unter der Schädeldecke ist, schaltet sich ab. Alles wird dunkel und für kurze Zeit sehr kreischend laut und dann still. Es durchläuft mich wie ein elektrischer Schlag vom oberen Ende der Wirbelsäule durchs Rückenmark bis in Höhe der Brustwirbel, von hinten ins Brustbein, runter zu den Lendenwirbeln. Die Knie werden weich. Und dann geht der Sturm hinter den Schläfen los, als wäre ein neues Betriebssystem hochgefahren worden. In grau, stürmisch laut. Aaaaaaaahhhhhhh!
Wie lange noch?
Wie lange noch? Wie hoch ist das hier? Ist man tot, wenn man hier aus dem Fenster fällt. Tut es weh, wenn man vor eine S-Bahn stürzt? Kann ich nicht einfach weg sein. Ich habe hier nichts zu suchen, keine Berechtigung und ich will auch nicht mehr.
So geht das, ich weiß nicht mehr wie lange. Tage? Wochen? Es dauert mehrere Monate. Es kommt mir vor wie Jahre. Unendliche Jahre, in denen ich nichts wirklich tun kann, obwohl ich funktioniere. Ich kann kochen, einkaufen, den Abwasch machen, mit dem Hund gehen. Ich kann Auto fahren, Radfahren, Bus fahren oder gehen. Ich kann alles tun. Ich bin nur nicht dabei. Alles geht mechanisch, ohne meine Anwesenheit, ohne mein Zutun, ohne meine Entscheidung. Ich spule die Dinge ab. Ich rede ganz normal mit den Menschen um mich herum und schätze dabei ab: Zwei Schritte bis zum Fenster. Ist das tief genug? Im Hintergrund läuft das ständige Ich-will-tot-sein-Rauschen. Würde diese Pistole da im Schaufenster wirklich tödlich sein. Kann man die einfach so kaufen? Ich kann den Verkäufer doch nicht fragen, ob man damit einen Menschen, oder auch nur sich selbst umbringen kann. Der drückt doch auf den Knopf unter der Theke und ich komme da gar nicht mehr raus, direkt in eine Zwangsjacke. Das muss anders gehen.
Als wäre eine Tür aufgegangen,
die ich vorher nicht kannte, und die jetzt immer einladend da ist, wenn mir alles zu viel wird, wenn ich wegwill. Ein Gedankenmuster, eine automatische Reaktion, eine Verhaltensweise, die eingeübt und abrufbar ist, wie ein oft trainierter Bewegungsablauf. Ein Fallrückzieher, ein Fosbury Flop. Ein kleiner Trigger genügt und ich renne durch diese offenstehende Tür – ins Dunkel. Alles shuttet down in Bruchteilen von Sekunden.
Torkelnd in geräuschloser Schwerelosigkeit, von tief unter Wasser, verschwommen, lichtlos und gedämpft weiß ich, dass die Menschen leiden unter meinem Zustand, meiner Abwesenheit. Es tut mir leid und ich schäme mich. Das ist das Gefühl, da ist es. Ich schäme mich, dass ich so dämlich bin. Wie kann man so dämlich sein, so geliebt zu werden und so – ja was, traurig sein? Nein lebensmüde. Müde. Ich will nur raus. Dieses dumpfe Nichtsein soll aufhören. Endlich aufhören. Und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als dieses kleine Gasflämmchen auszudrehen. Nein, selbst das nicht, ich hoffe, dass es von selber ausgeht. Meine Gedanken drehen, kreisen, torkeln ununterbrochen darum. Während ich vordergründig mit jemandem rede, frage ich mich in der anderen Gehirnhälfte, ob der Staubsaugerschlauch auf den Auspuff passt. Und vom Auspuff in den Fahrgastraum. Und ja, er passt und lässt sich mit Gaffa-Tape befestigen. Oder doch die Hundeleine, immer wieder die Hundeleine.
Weg sein, einschlafen, nicht mehr aufwachen, zu Moos werden. Niemand erschrecken, niemand zur Last fallen, nie dagewesen sein.
Dann liege ich irgendwann zusammengekrümmt auf dem Boden, manchmal schaffe ich es unter die Bettdecke. Wenn ich draußen bin, versuche ich eine Stelle zu finden, wo ich mich möglichst unbemerkt hinlegen kann.

Und dann passiert etwas Unerwartetes.
Ich sehe auf von den Büchern, die aufgeschlagenen vor mir auf dem großen grünen Tisch liegen. Ich sehe. Sehe etwas außerhalb von mir. Ich sehe nach außen, nehme etwas wahr, mit Interesse, stehe auf und gehe an eines der Regale, die die Wände des Lesesaals verkleiden. Sie sind zum größten Teil bestückt mit Nachschlagewerken, Enzyklopädien und Lexika. Aber da gibt es auch ein schmales Regal, in dem Zeitschriften stehen. Kunstzeitschriften. Aktuelle Kunstzeitschriften über aktuelle Kunst. Gift also.
Zu diesem Regal gehe ich. Ist das verboten? Wird mich irgendjemand aufhalten? Wird jemand sagen, hey, wo wollen Sie denn hin? Bleiben Sie mal bei ihren Büchern und spazieren Sie hier nicht im Lesesaal umher und schon gar nicht an dieses Regal. Sie jedenfalls nicht. Außer dem Gebrüll in meinem Kopf, sagt natürlich niemand etwas. Niemand bemerkt es. Und wen sollte es auch interessieren? Ich stehe vor dem Regal. Die Art, die Flashart, das ArtForum, das Kunstforum international, alle. Ich weiß nicht mehr, welches ich vorsichtig aus dem Regal ziehe, aufschlage. In welches ich hineinblättere. Neue Kunst. Ich nehme ein oder zwei Ausgaben mit an meinen Platz. Und blättere, schaue Fotos an, Abbildungen.

Am gleichen Tag
oder am Tag darauf oder eine Woche später, hole ich, wenn ich allein in der Wohnung bin, Papier hervor. Kleine Blöcke, nicht größer als Din A6. Und zeichne. Mit Bleistift zuerst, dann mit Ölkreide, schwarz und weiß. Heimlich. Ach du Scheiße, ich bin wieder an der Nadel. Ich fange wieder an. Das soll doch nicht sein. Das ist doch eine der Ursachen allen Übels, ich bin doch jetzt auf der anderen Seite, auf der wissenschaftlichen Beobachter-, Interpreten-, Erklärerseite. Auf der sicheren Seite.
Ich schäme mich. Warum bin ich ein solcher Versager, der einfach nicht eine ganz normale Dissertation zu Ende schreiben kann. Ich habe große Schuldgefühle. Die Universität hat mich, als es mir schlecht ging, aufgenommen, mir meinen Platz gegeben, mich teilnehmen lassen, mir Stempel, Bescheinigungen und Zeugnisse gegeben. Mir Aufgaben gestellt, die ich leicht lösen konnte, ich habe zig Scheine gemacht, italienisch gelernt, und eine sehr gute Prüfung für die Promotionszulassung abgelegt. Sie haben mir sogar einen Job gegeben. Warum kann ich das jetzt nicht zu Ende bringen?
Ich fliüchte aus dem Entzug. In and out of rehab.

Bevor sie nach Hause kommt,
verstecke ich die Zeichnungen und alle Utensilien, eine kleine Schachtel mit schwarzen und weißen Jackson Kreiden, hinten in einer der Schubladen meines Bisleyschranks. Ich werde das wieder in den Griff kriegen. Aber es fühlt sich gut an.
Ich bekomme wieder Luft. Rieche den anbrechenden Sommer und ich habe Lust auf einen Milchkaffee.
Ich sehe mich in einem Café sitzen, Zeitung lesend und einen Milchkaffee trinken. Ein Satz mit: ich habe Lust. Kurze Zeit später sitze ich in einem Cafe beim Milchkaffe.
Irgendwann, Monate später, schreibe ich einen Brief an meinen Doktorvater, in dem ich ihm das alles zu erklären versuche. Ihm erläutere, dass ich die Dissertation aufgeben würde und dass ich mich wieder mit meiner eigenen Kunst beschäftigen müsse. Er reagiert mit sehr viel Verständnis und mir bleibt ein Satz aus seinem Antwortbrief hängen. Es ist doch immer wieder erschreckend, wie wenig man voneinander weiß. Ja, auch wie wenig man von sich selbst weiß.

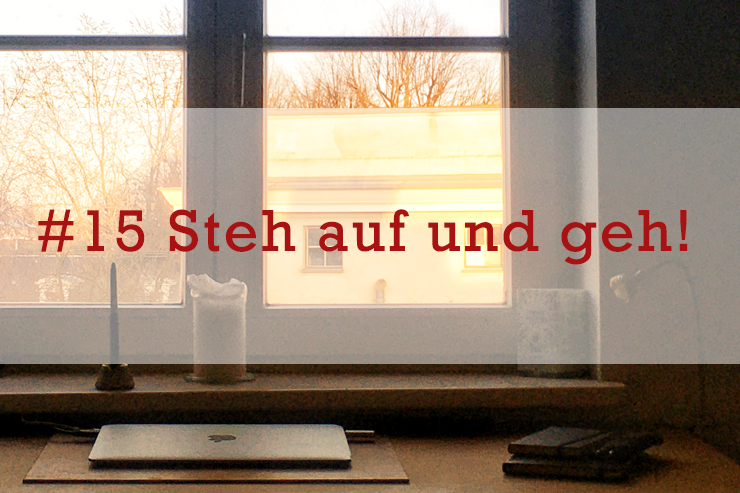


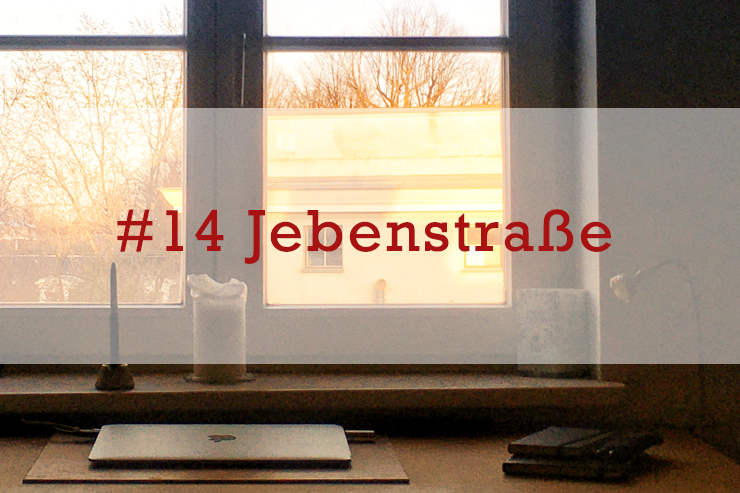

18 Comments