Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#16 Teezeremonie
— 2007
Ich sitze auf dem Boden in der Küche. Die Kerze vor mir flackert im Fastdunkel. Ganz leicht. Mittlerweile kann ich meinen Rücken gerade halten, im Schneidersitz, auf dem dünnen Kissen. Die CD mit der Meditationsmusik läuft auf Repeat. Jetzt seit zwei Stunden. Auf dem Herd im großen Topf simmert der Tee.

Tee?
Nein, das hat nichts mit Tee zu tun. Das hier sind Blätter, Blättchen und kleine Zweige, winzige vertrocknete Beeren, zermörserte Pilze, Baumrinde und pulvrige Erde, als hätte sie einen Waldboden ausgesiebt, meine neue sehr nette, sehr leise, aber auch sehr entscheidungssichere chinesische Ärztin.
Hat sie das alles mit feinen Fingern und dünnen Pinzetten in die unzähligen Fächer des wunderschönen hölzernen Schubladenschrank sortiert, um mir dann aus dieser Apotheke auf einer kleinen Waage – wie ich sie schon öfter in Zusammenhang mit anderen Drogen gesehen hatte – genau abzuwiegen, zu mischen und auf Papiertüten zu verteilen, was ich brauche, um wieder atmen zu können?
»Isse no aschma« erkennt sie an meiner herausgestreckten Zunge. Wenn es kein Asthma ist, was ist es dann?
Das sagt sie mir entweder nicht so genau oder ich überhöre es. Irgendetwas ist jedenfalls, da ist sie sicher und soviel verstehe ich dann doch, aus dem Gleichgewicht. Und sie, sie weiß eine Methode, mit der sie dieses Gleichgewicht dabei unterstützen kann, sich wieder einzustellen. Tee. Okay. Dann Tee.
Eine Tüte für jeden Tag der nächsten Woche. Und der übernächsten. Und dann erklärt sie mir, wie ich den Tee kochen und trinken soll. Trinken? Nope. Das eigentliche Trinken ist nur ein kleiner Teil der gesamten Prozedur oder ist es eine Zeremonie. Je nachdem. Manches schwimmt zunächst oben, einiges sinkt gleich auf den Grund. Noch ist das Wasser kalt im großen Topf. Eine erste halbe Stunde weicht der Waldboden ein. Eine erste halbe Stunde, in der ich vor der Kerze sitze. Ist das meditieren? In der linken unteren Ecke steht der Mond im Fenster. Gestern war er noch nicht einmal halb. Wenn es Zeit ist, das Wasser langsam, sehr langsam auf der kleinsten Flamme zu erwärmen, wird der Mond, wenn mein Blick von der Kerze weggezogen wird, die erste Fenstersprosse streifen. Das Wasser wird warm, wärmer. Der Raum füllt sich mit dem Duftgestank. Es beginnt zu blubbern.
Und da sitzt er.
Der Urgroßvater in seiner grünen Decke, und all die anderen Alten, und nicht so alten Silikosekranken, und kriegen keine Luft. Wie der Vater keine Luft bekommt. Die Adern zu vom Qualm der Zigaretten. Da schaue ich mir das also ab. Wir Männer kriegen keine Luft. »Isse no aschma« Doch ist es, was bleibt mir übrig, ich rauche doch nicht und unter Tage war ich nicht lang genug. Die paar Monate in den Semesterferien. Das reicht doch nicht für Steinstaublunge.
Die Sprosse teilt den Mond jetzt genau am Terminator. Rechts die helle Hälfte, links nur schwarzer Himmel, nichts zu sehen, nur zu wissen, dass da noch eine dunkle Hälfte ist.
Noch zehn Minuten köcheln lassen, dann stehe ich auf. Will aufstehen. Die Beine sind nicht da. Auf den Knien warte ich bis das Gefühl zurück kommt und ich wieder spüre, wo meine Füße sind. Noch das Tütchen mit dem speziellen Pulver, das nicht so lange erhitzt werden darf, drei Minuten vor dem Abseien in den Zaubertrank geben.
Die Flüssigkeit, ein dicker Saft, ungefähr ein großes Trinkglas voll. Ein kleiner Schluck vom stinkenden Gebräu. Ist das bitter, faulig oder schon Verwesung, was kann denn so schmecken? Und noch ein Schluck. Das Glas noch immer beinahe voll. Also los, zwei Schlucke, schnell und dann noch einer.
Das nasse Kraut kommt wieder in den Topf, wird aufgegossen randvoll mit kaltem Wasser auf kleiner Flamme. Und ich, ich sitze wieder auf dem Kissen. Die Beine untergeschlagen. Die Kerze steht ganz ruhig.
Das Gesicht schwimmt weg. Die Tränen laufen mir.
Und Rotz kommt aus der Nase. Ist das alles meins?
Du musst kommen. Papa stirbt.
Er überlebt, hört auf zu rauchen, fängt sogar an zu kochen. Mit zerbeulten Hut und impotent von Beta-Blockern zieht er sich in den Garten, biodynamisch plant er die Einteilung der Ackerstreifen mit Lineal und Rechenschieber. Mich zieht die Mutter immer mehr auf ihre Seite. Unmerklich. Braucht mich. Selbstverständlich. Für Arbeiten, die er nun nicht mehr schafft.

Jetzt die heiße Flüssigkeit durch ein Tuch zum Fußbad in die Schüssel gießen. Vorsichtig, langsam stelle ich die Füße hinein. Die Kräuter in dem roten Tuch, hat sie gesagt, sind auf die nackte Brust zu drücken.
So sitze ich noch eine gute halbe Stunde.
Auch morgen wieder und übermorgen.
Der halbe Mond steht mittlerweile voll.
Und er wird aufgesägt und operiert. Einmal, zweimal. Immer wieder dillatiert. Die Medizin schreitet fort im Rhythmus der Infarkte. Die Rente, Abfindungen, Lebensversicherungen bescheren mit den Mieteinnahmen aus dem kleinen Haus erstmals ein Gefühl von Wohlstand.
Das Beste, was mir passieren konnte.
Er hat Vertrauen in die Medizin, die ihn immer wieder reparieren wird. Ein Techniker eben. Bezahlt mit Angst, Unsicherheit und Notaufnahmen lebt er noch fünfundzwanzig Jahre.
Ich werde hundertzwanzig. Was sitzt du denn in deiner Küche?
— Das müsstest du doch wissen.
Was ist das für ein Kraut, noch nie so etwas Scheußliches geschmeckt?
— Das geht dich gar nichts an. Lass mich in Ruhe.

Wir packen die Taschen. Die Kinder in die Kindersitze geschnallt sind es fünf Stunden Fahrt, wenn die Autobahn frei ist. Ihr Vater wird gerade aus dem künstlichen Koma geholt. Sie müssen sich noch etwas gedulden. Ich schlafe vor der Milchglasscheibe ein und sehe wie er mit meinem Herzen weiterlebt, stehe plötzlich auf dem Theatervorplatz in Bochum und träume noch einmal die Aufführung — welche ist das? während der sich ein Schauspieler einen blutigroten Ziegelstein aus der Brust reißt. Ein Herz aus Stein. Mit dem kann er nicht weiterleben. Er will meins.
Nun er wird nicht hundertzwanzig, sondern vierundsiebzig. Stirbt wie sein Vater im Jahr einer Fußballweltmeisterschaft. Kein Sommermärchen. Die Technik reicht nicht aus. Der Defibrillator, den man ihm in die Brust implantiert, um zu verhindern, dass er unbemerkt von allen Pflegern und vermutlich auch von ihm selbst, einfach sanft entschläft, hält ihn am Leben. Der sanfte Tod durch Kammerflimmern bleibt ihm erspart.
Aber dann heilt die kleine Wunde am Zeh einfach nicht. Wird allmählich größer. Der Zeh wird schwarz. Der Fuß heilt nicht, der Fuß wird abgenommen, dann der Unterschenkel unter dem Knie, dann überm Knie. Unter dem Krankenbett bildet sich eine große Blutlache. Auf dem Operationstisch ist er dann tot.
Aber auch das merkt er nicht.
Jetzt steht er hier am Fenster. Verdeckt den Mond.

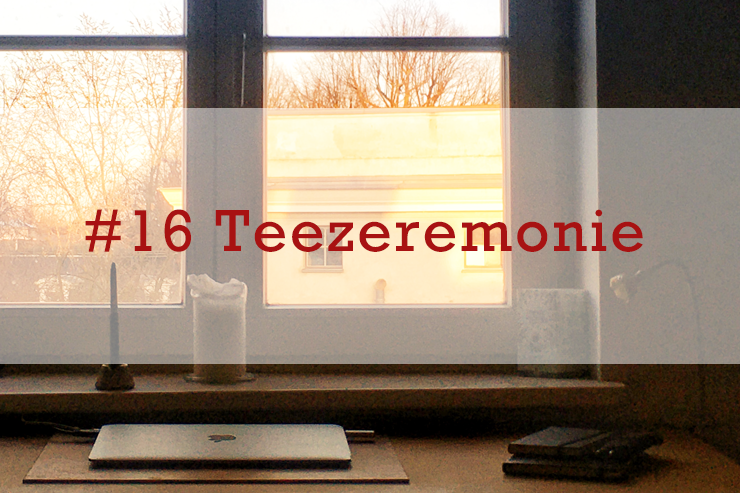





19 Comments