Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#21 Brotjob
— 1994
Zehn Jahre später. Wieder Winter.
Spätwinternebel steht über dem Teltowkanal. Am anderen Ufer verschwimmen Reste der Berliner Mauer. Auch auf dieser Seite dimmt das Winterlicht die Farben. Angenehm für meine Augen. Das Grün der Weide ist ins Bräunliche, ins Blassgraue verschoben. Das Gatter ist verwittert. Winterponys dampfen auf der blassen, hartgefrorenen Erde. Warmer Atem steigt aus ihren Nüstern, löst sich in Spiralen auf. Über ihnen eine Wärmewolke, unsichtbar, hüllt sie ein, wie meine Wärme mich.
Gedämpft auch die Geräusche. Das Schnauben der Pferde. Meine Schritte auf dem Uferweg. Das sanfte Aneinanderstoßen der Eisschollen im Stichkanal. Trotzdem klar und weit zu hören, als seien nur die oberen Frequenzen vom Nebel weggepegelt. Selbst die rostigen Gitterstufen der kleinen Brücke scheppern heute nicht. Schwarzweiß mit Granulat vermischt liegt hier noch harter Schnee, den jemand vor ein paar Wochen mal vom Weg geschoben hat.
Auf der Brache dahinter sind unter einer dünnen Schicht von Schmelzwasser die Pfützen noch vereist, knacken leise unter meinen Schuhen. Wildes Gestrüpp und kahle Bäume. Wintertiere leben hier. Noch riecht es nicht nach Frühling. Mit Schrott beladen, tief im Wasser liegend taucht die Silhouette eines Schubverbandes hinter Nebelschwaden auf, gleitet an mir vorbei. Genauso tief das stille Dieselwummern hier am Rand der Stadt. Am ehemaligen Ende der »Freien Welt«.
Ich biege ab, durch Schrebergärten, die im Winterschlaf verwaist sind, wo halbzerfetze Herthafahnen schlaff herunterhängen, das Blau auch ausgeblichen, das Weiß eher in der Farbe eines Winterregens. Strahlend dagegen, etwas später, die eisglatt festgetreten Wege im blätterlosen Park. Durch das nasse Sepiaschwarz der Äste scheint eine trübe Sonne, auch noch als ich in der S-Bahn sitze.
Links gleitet der Verkehr in Richtung Mitte. Spritz Schneematsch. Stockt. Rechts wieder Schrebergärten. Im Matsch planiert ein Bagger Schlamm. Mein Atem schlägt vor mir auf der Scheibe. Geäst ohne Blätter, Wintergras, beinahe Schilf. Dann plötzlich Westkreuz. Wohnbebauung, Hinterhöfe. Durchschnittene Häuser. Die Rückseite der Stadt an die Trasse gebaut. Verblasste Graffitti. Im großen Bogen zum Hackeschen Markt, halb zugenagelt noch die Treppe provisorisch gezimmert.
Auf dem Weg zum Marstall sehe ich ihn schon, wie vorübergehend abgestellt hinterm Bauzaun an der Spree, den Palast der Republik. Drecksgelb spiegelt die Fassade. Hinein geht es aber durch den Marstall gegenüber. Ich weise mich aus. Jemand zeigt mir den Weg zum Keller, gibt mir einen Code für die Zwischentüren im langen Tunnel. Unterirdisch geht es dann hinein.
Dann bin ich allein mit all den Geistern. Kalt und verstaubt stehen die Rolltreppen. Von den Decken tropft es langsam in den Staub der Teppichböden. Wer hat diese Raumstation verlassen und warum? Hier hat Honecker geschlafen oder telefoniert. Die Domheiligen von gegenüber fest im Blick? Ich baue die Stative auf. Fürs Licht und für die Kamera. Lege den Massstab an, die Farbkarte und die Raumnummer ins Bild und drücke ab. Das erste Bild. Von wieviel tausend?
Schwingt hier leise das Lachen der vergangenen Jugend über den drehenden Tanzboden? Kann ich das hören? Unsichtbare bleiben schattenhaft zurück. Kann ich das sehen? Hinter Atemschwaden verdampft das Bild. Stillgelegte Treppen führen tief ins leere Wrack. Es tropft. Doch die alten Piktogramme zeigen Überfüllung an. Noch ein Foto und noch eins vor dem Bildersturm der Republik. Entropie. Meine Energie verdampft in die Umgebung.
Ich muss zurück, bald geht es durch Asbestschleusen. Ich tauche auf. Hole Luft im Lärm der Stadt. Draußen drehen sich Baukräne weiter im gelben Baukranwinterlicht. Schnell für die Rückfahrt ein Snickers gekauft. Bringt auch verbrauchte Energie zurück. Und Trost. In engen Kurven kreisch die S-Bahn auf.
Beinahe so fein wie Nebel sticht mir Eisregen ins Gesicht. Ich liebe diese Stadt im Winter. Streusalz, Asche, Granulat unter meinen Schuhen und harter Schnee am Straßenrand, den Mantel hochgeschlagen vor den vielen Menschen hier und den Bus verpasst. So ein Glück. Zu kalt zum Warten, gehe ich in die Bücherei. Schon das sanfte Licht von außen, der Blick auf die Regale löst einen Schwall von Freude in mir aus. Und dann erst der Geruch. Ich bringe Bilderbücher mit und Wumme für die Kinder.
Ich muss jetzt los.


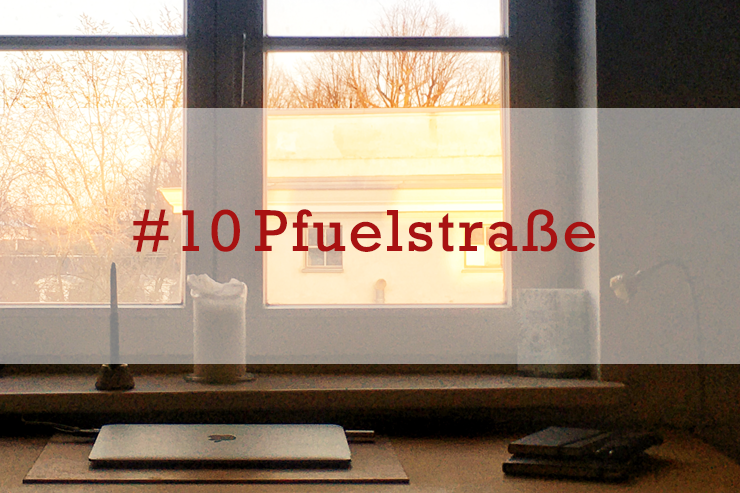
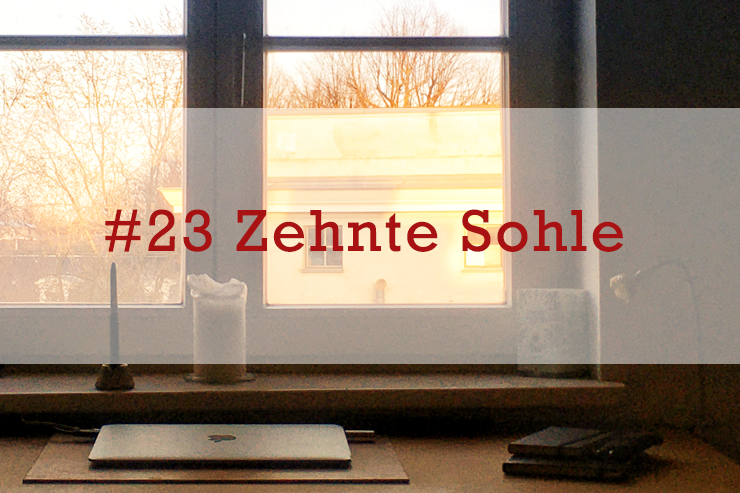



No Comments