Das Problem des Schriftstellers, überhaupt des Künstlers, ist doch, daß er sein ganzes werktätiges Leben versucht, auf das poetische Niveau seiner Träume zu kommen.
(Heiner Müller)
#40 Die Brücke
In einer feuchten Nachtlandschaft, einem Sumpfgebiet, finden wir ein Haus. Wir, das heißt ich bin nicht allein, spüre noch andere Energien um mich, mehr oder weniger vertraute Menschen, ohne zu wissen, wer das ist. Der Traum lässt es offen.
Das Haus steht leer, unbewohnt. Eine aufgegebene Gaststätte, ein ehemaliges Landgasthaus, oder eher ein Ausflugslokal, das nur an zwei Tagen in der Woche oder im Monat oder im Jahr geöffnet hat.
Ich sitze mit einem »guten Freund« an einem der staubigen Tische, wir sind sehr vertraut, wie sich alte Freunde aus Schultagen kennen, wenn sie sich auch Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen haben. Wir unterhalten uns unter schummrig gelbem Funzellicht. Die anderen bleiben draußen in der dunklen Nacht.
Da kommt der Mann, ein Vater, oder nein, der Schuldirektor meiner Kinder herein. Zündet sich noch in der Tür eine Zigarette an. Schaut sich um. Entdeckt uns. Sagt dann plötzlich aggressiv, vorwurfsvoll: »Es ist übrigens sehr laut da draußen.«
Ich brauche einen Moment, bis ich verstehe, dass er meint, wir redeten zu laut. Wir stören ihn, wenn er da draußen rumsteht oder sitzt.
Ich raste (zu meiner Überraschung) aus. Fasse mich schnell und sage ihm ruhig (wieder mit überraschender Vehemenz und Macht) er soll sich verpissen. Leise und bestimmt: »Raus hier und verpiss dich!« Er ist geschockt, das hat er überhaupt nicht erwartet. Ich auch nicht, aber ich meine es ernst. Er geht raus.
Ich setze mich wieder. Wir reden weiter. Die Freundin aus Kindertagen und ich.
Eine Frau kommt in den Saal, die Mutter — seine oder meine? —, seine, die des Schuldirektors, fragt: »Was war los?« Ich erkläre es. Sie ist seltsamerweise auf meiner Seite. Versteht es, versteht mich.
Kinder strömen durch die Tür. Die kleinen Schulkinder des Direktors und die schon jugendlichen Nachbarskinder. Genauer, die vielen Kinder des einen Nachbarn, der gerade noch vom Schuldirektor verkörpert wurde. Ich erkläre dem ältesten Nachbarssohn, dass es mir leid tut, es aber nicht anders ging. Sein Vater muss sich verpissen. Er weint. Weint heftig an meiner Schulter. Versteht es aber. Lässt sich von mir trösten. Mehrere Kinder weinen. Ich gehe mit ihnen vor die Tür. Da kommt der Schuldirektor, der jetzt der Nachbar ist, zurück. Er hatte sich nicht verpisst, war nur ums Haus gegangen. Ich sage ihm nochmal, dass es ernst ist.
Wir sitzen hier und unterhalten uns am Tisch. Leise in normaler Lautstärke. Keine Musik, weder live noch aus der Musikbox. Kein Gebrüll, kein Streit. Genauso, wie ich es eben auch den anderen erklärt habe, der Mutter, den Kindern. Es wiederholt sich mehrfach. Der Schuldirektornachbar gibt auf, geht endgültig im Dunkeln am Sumpfbach entlang weg.
Die Mutter, die Kinder gehen auch. Wollen zum Auto, um nach Hause zu fahren. Ich sehe wieder, wie so oft, die Traumcollage einer Kreuzung in Essen Steele, Kettwig, am Baldeneysee. Diesmal von unten aus der Froschperspektive, aus den Flusswiesen, dem Überschwemmungsland. Aber die kleine Kohorte kommt nicht auf dieser Straße, sie geht auch am dunklen Bach entlang. Sie wollen den Direktor, Nachbarn, Vater, Ehemann einholen. Nein, sie wollen es eigentlich nicht, aber sich trauen sich nicht, das zu denken. Sie spielen die Beeilung nur, auch ohne es sich einzugestehen. Der Abstand wird unmerklich größer.
Zwischendurch ist das Restaurant voll geworden, proppevoll. Zwischendurch? Jetzt ist es voll. Fertig. Die Frau, die Mutter, kommt wieder herein. Will noch einmal wissen, was los ist. Ich beginne, zu reden, merke dann aber, dass ich, da sie sich an den Nachbartisch gequetscht hat, jetzt wirklich über den Kneipenkrach hinweg brülle. Ich bitte meine Tischgenossen, auf der Sitzbank neben mir Platz zu machen, etwas zu rücken und winke die Frau, die Mutter an meinen Tisch. Aber sie hat schon alles verstanden und geht raus.
Wir, der gute Freund und ich, vom plötzlichen Gedränge genervt, machen uns auch auf. Laufen den Weg entlang an dem jetzt breiten, dunklen Bach. Eins der Kinder kommt uns entgegen, zeigt stolz ein Bündel langer, zusammenhängender Federn. Und da findet es ein noch größeres, prachtvolleres, ein – ja – Indianerschmuck, den es sich gleich auf den Kopf setzen will. Aber ich sehe, Wirf das weg! dass es noch Knochen, Sehnen und gammelige Fleischreste sind, die das Federbündel zusammenhalten. Das Kind schaut mich ungläubig an. Merkt dann, was ich meine. Auf der steilen Uferböschung liegt ein toter Vogel. Es sieht die Federn an, wirft sie geschockt und angewidert weg. Eine Ente, ein Reiher. Kraniche, Gänse liegen da zu Dutzenden, treiben zum Teil im Wasser. In verschiedenen Verwesungs- und Auflösungsstadien. Sumpfland.
Dann weiter. Wir, der gute Freund und ich, staksen durch die Wiesen auf der Uferböschung über die verendeten Vögel und die Verwesungsreste weg. Ich spüre aber, dass es bald aufhört. Wir haben die Strecke der toten Vögel hinter uns gelassen.
Aber jetzt sind wir, der gute Freund und ich? — nein, ich bin jetzt allein unter vielen, die dort in den nassen Sumpfuferböschungen umherlaufen, und dort liegen, statt der Vögel, Soldaten. Die toten Gesichter eingefallen, grün vor Schimmel. Manche liegen nebeneinander, gleichzeitig erschossen, hingerichtet, an Ort in Stelle in Reih und Glied gefallen oder vielleicht erst nach dem Sterben von Überlebenden in die parallele Ordnung geschleift? Andere liegen kreuz und quer, wie sie im Angriff oder auf der Flucht gestorben sind. Schon länger tot, manche skelettiert, nur noch Uniformreste im Lehm. Die Helme, wo sind die Helme? Hat den jemand alle Helme mitgenommen? Nein, da liegt noch einer im Schlamm unter dem Schädel.
Ich spüre neben mir den starken Freund, schaue mich nach ihm um. Sehe wie er taumelt. Ihm ist schlecht. Er ist der Ohnmacht nahe. Ich fange ihn auf. Stütze ihn, lege seinen Arm um meine Schulter. Gehe mit ihm torkelnd weiter. Es geht einigermaßen. Ich werde etwas größer, spüre eine unbekannte, überraschend starke Kraft in mir. Ihm Sumpfweg stecken immer mehr Feldsteine, geben als feste Inseln den Tritt vor. Bis sie endlich einen dicht gepflasterten Weg bilden, eine Ufermauer, eine schmale geländerlose, grob gefügte Feldsteinbrücke, die sich nicht direkt über den Fluss schwingt, sondern in einigem Abstand mehr oder weniger parallel zum Ufer verläuft. Viele Menschen sind dort unterwegs. Der Freund verliert jetzt wirklich das Bewusstsein. Gleitet weg. Ich schaffe, dass er nicht ins Wasser fällt, mir nicht aus den Armen und von der Brücke rutscht.
Ich lege ihn kurz hin, zwischen all die Menschen. Knie mich neben ihn. Lege seine Füße hoch auf meine Schultern. Bekomme ihn so wach, wir können weiter. Es sind nur noch wenige hundert Meter. Wir schaffen es mit einigen – beinahe – Stürzen. (welcher Freund ist das? ist es mein Bruder? bin ich das selbst?)
Wir kommen auf einen Schotterfeldweg. Ein Feld! Trocken. Kein Wasser, keine Brücke mehr. Viele überholen uns, einige kommen uns entgegen. Da erkenne ich unter ihnen auch zwei alte gute Freundinnen aus dem besetzten Haus. Sie bleiben stehen. Ungläubig. Ihre Augen füllen sich mit Tränen, schimmern feucht vor Rührung, uns zu sehen. Ich weine hemmungslos.


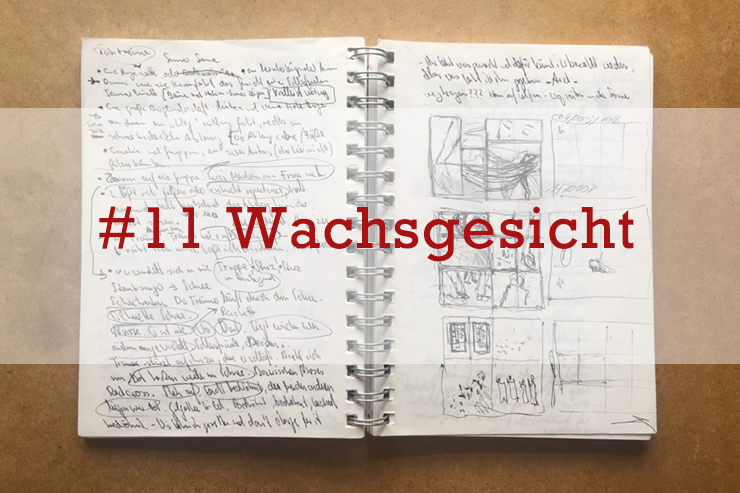
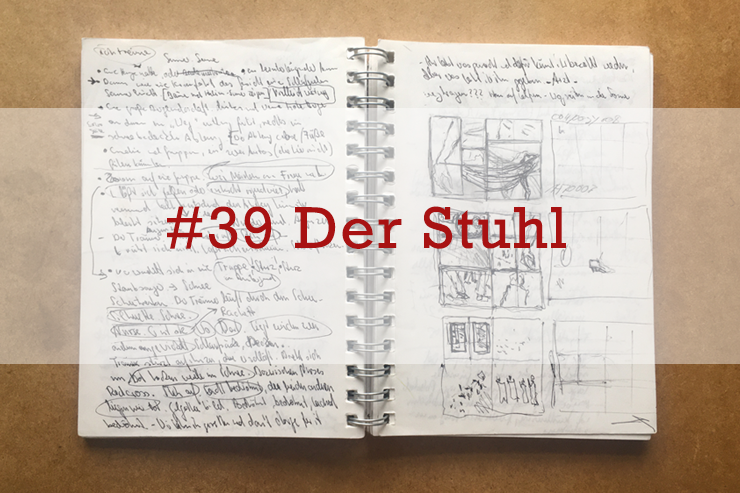



No Comments