„Im Meer waren wir nie“ von Meral Kureyshi
„Im Meer waren wir nie“ von Meral Kureyshi erzählt die (auto)fiktionale Geschichte einer namenlosen Ich-Erzählerin, die ihr Leben weniger lebt als geschehen lässt. Gestrandet bei und mit der besten Freundin Sophie und ihrem neunjährigen Sohn Eric, ist sie die verlässliche Größe, der Babysitter, der Mensch, den man um alles bitten kann, der aber selbst keine Bitte stellt. So pflegt sie auch die Großmutter von Sophie, die im Altersheim Betreuung braucht. Überqualifiziert – doch der Job wird besser als andere bezahlt.
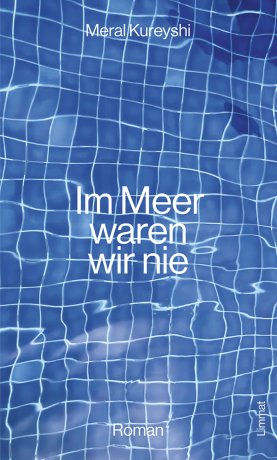 In vielen Snapshot bekommen wir Einblick in das Leben der Ich-Erzählerin, die eine genaue Beobachterin ist und es versteht, sich unsichtbar zu machen. Ihre Gefühle sind zweitrangig, überfallen sie regelmäßig in Panikattacken, die ausgehalten werden. Eigene Bedürfnisse scheint sie nicht zu haben, die Vermeidung von Schmerz ist schon viel.
In vielen Snapshot bekommen wir Einblick in das Leben der Ich-Erzählerin, die eine genaue Beobachterin ist und es versteht, sich unsichtbar zu machen. Ihre Gefühle sind zweitrangig, überfallen sie regelmäßig in Panikattacken, die ausgehalten werden. Eigene Bedürfnisse scheint sie nicht zu haben, die Vermeidung von Schmerz ist schon viel.
„Ich will keinen Trost, das ist demütigend“. (aus: „Am Meer waren wir nie“)
In ihrem überschaubaren kleinen Kosmos beobachtet sie die Schwester, die zehn Jahre jünger ist und sich besser einleben konnte, unbeschwert ist. Oder ihre beste Freundin Sophie, die in einem Haus mit Pool und Büchern aufgewachsen ist. Dort hätte die Ich-Erzählerin lieber gelebt.
„Zu Hause ist mehr ein Gefühl als ein Ort. Weil es den Ort nicht mehr gibt. Viele Versuche, ihn wiederherzustellen. Es gelingt auch nach dreißig Jahren immer noch nicht.“ (aus: „Am Meer waren wir nie“)
Zwischen den verschiedenen Lebensentwürfen von Frauen: Sophie, die von ihrem Mann misshandelt wurde und ihren Sohn Eric nun allein (mit der Ich-Erzählerin) aufzieht. Klara, die Mutter von Sophie, die oft in Ausstellungen geht. Lilli, die Großmutter von Sophie, die ihre eigenen Erinnerungen teilt, während sie immer vergesslicher wird, schwächer und schließlich stirbt.
Mit dem Begräbnis von Lilli beginnt der Roman und erzählt dann in einer Rückschau den Weg dorthin. Denn als Lilli stirbt, ist die Ich-Erzählerin zum ersten mal frei und geht ihren eigenen Weg, weg von Sophie und Eric. Ihre Schwester wird in ihr Zimmer einziehen.
Ein letzter Abschied, die Asche von Lilli wird im Meer verstreut und dann beginnt mit 38 der neue Lebensabschnitt.
Die Autorin
Meral Kureyshi kommt aus dem kosovarischen Prizren (ehemaliges Jugoslawien). Ihre Familie gehörte der türkischsprachigen Minderheit im Kosovo an. Die Familie ist in die Schweiz geflohen, dort hat sie ihre Kindheit und Jugend verbracht. Sie hat am Schweizer Literaturinstitut studiert und war mit ihrem Debütroman: „Elefanten im Garten“ auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises. In ihrem ersten Roman thematisiert sie die Flucht aus dem Kosovo und den Verlust des Vaters, sowie die Integration in der Schweiz.
Die Sprache
Kureyshis Sprache ist meisterhaft schlicht und lapidar. Der Schmerz- und Trauerteppich, der sich so sprachlich entfaltet ist oft schwer erträglich und gleichzeitig wichtig. Dieser Schmerz durchzieht den Roman. Eine Sehnsucht nach einer Heimat, die für immer verloren ist, genauso wie der früh verstorbene Vater.
Fazit
Themen wie Migration und Flucht bestimmen immer mehr die täglichen Nachrichten. Der Schmerz derjenigen, die fliehen mussten, wird selten thematisiert. Umso wichtiger sind Bücher und Texte von Autor:innen, die uns dies nahebringen. Dies ist keine Lektüre für zwischendurch, dient nicht der Unterhaltung oder auch Belehrung. Im Lesen der fragmentarischen Erinnerungen und Ereignisse wird die Zersplitterung eines Lebens deutlich, in der die Sprache/Literatur zu einer neuen Heimat wird.
„Ich lebe zwischen den Sprachen in meinem Kopf. Keine davon begleitet mich ein Leben lang, was zur Folge hatte, dass ich in keiner zu Hause war. Somit beherrsche ich keine, ich weiss auch nicht, ob man eine Sprache beherrschen kann.“ (aus „im Meer waren wir nie“)
„Im Meer waren wir nie“ von Meral Kureyshi
gebunden mit Schutzumschlag, 216 Seiten
Februar 2025
978-3-03926-085-0

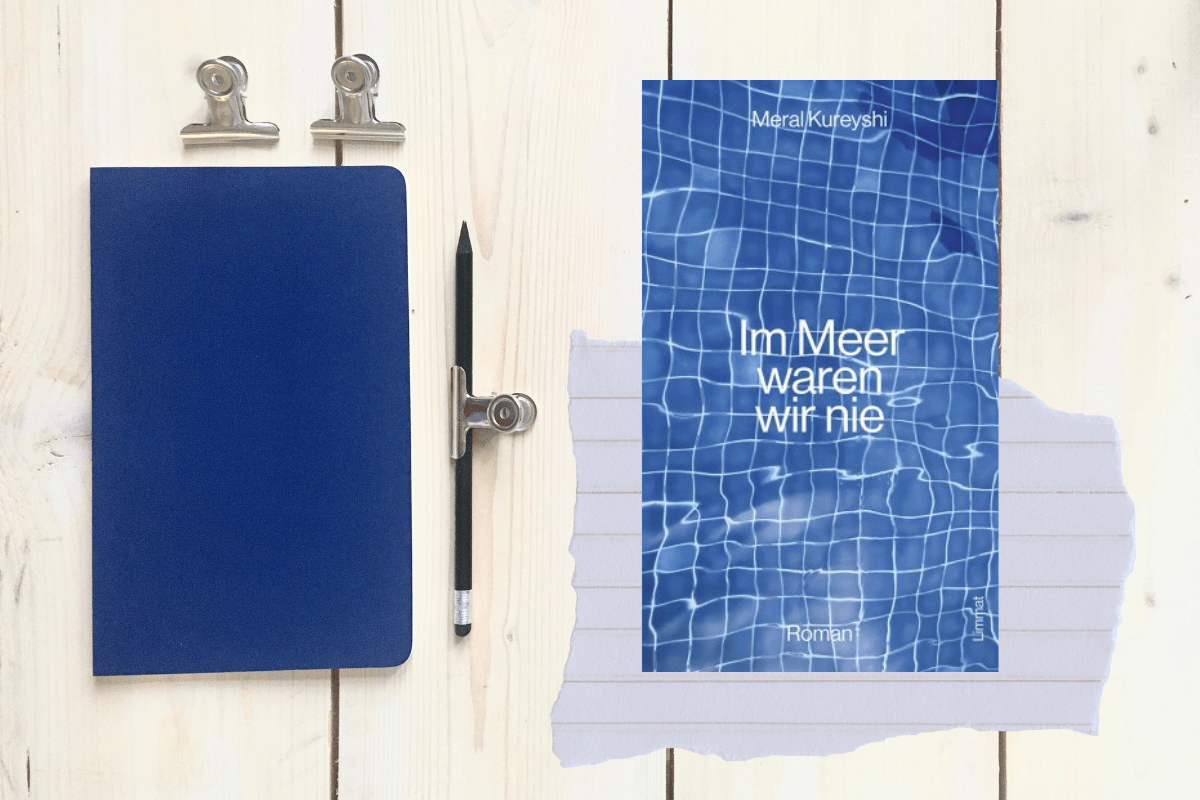


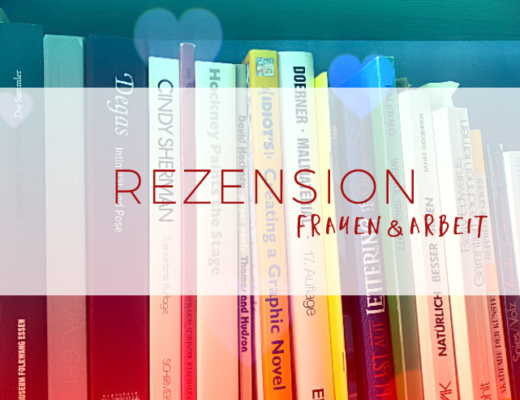
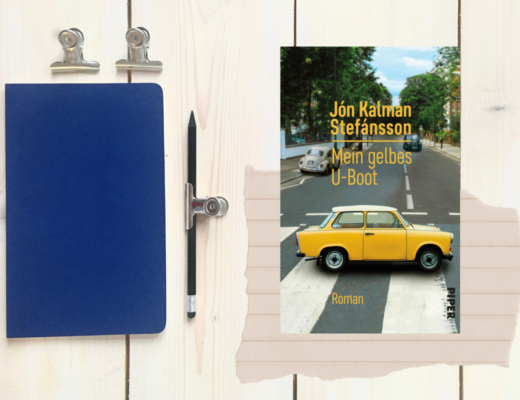
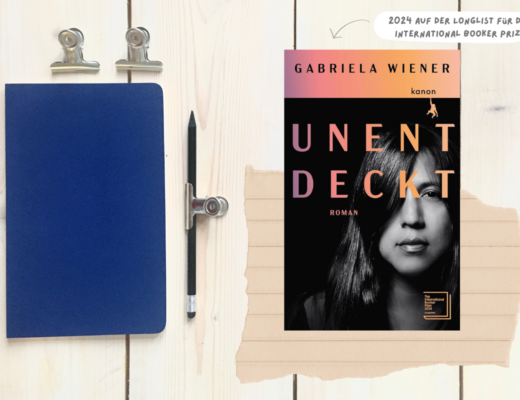
No Comments