Liebe Autor*innen, liebe Leser*innen, heute geht es in der Reihe über autobiographisches Schreiben um Die Welt im Rücken von Thomas Melle, erschienen 2017 bei Rowohlt, Berlin. Ein Buch, das man nicht schreiben möchte, aber lesen sollte.
Es ist das radikalste autobiographische Buch, das ich je gelesen habe. Es ist eine Zurückeroberung der eigenen Geschichte durch die exakte Beschreibung der Unfälle.
Klappentext
Thomas Melle leidet seit vielen Jahren an der manisch-depressiven Erkrankung, auch bipolare Störung genannt. Er erzählt schonungslos und sprachlich brillant von seinem Umgang mit der Krankheit, von persönlichen Dramen und langsamer Besserung – und gibt so einen außergewöhnlichen Einblick in das, was in einem Erkrankten vorgeht. Die fesselnde Chronik eines zerrissenen Lebens, ein autobiografisch radikales Werk von höchster literarischer Kraft.
Der Kappentext klingt fast verniedlichend, wenn man das Buch erst aufgeschlagen hat. Und sofort wird klar, wie richtig und dennoch nichtssagend Adjektive, wie schonungslos, radikal oder Wendungen wie Umgang mit Krankheit, persönliche Dramen, zerrissenes Leben sind. Sie werden kaum dem gerecht, was Melle in seinem Buch beschreibt.
Ich habe oft gehofft, dass Melle übertreibt und erfindet. Aber das tut er wohl leider nicht.
Ja, was macht er? Er erzählt in drei Teilen, gerahmt von einem Prolog und einer Rückschau, von den drei schweren manischen Schüben, die ihn sein Leben gekostet haben. Sein Leben wie er es kannte, wie er es sich vorgestellt und begonnen hatte?
Eine Erzählung
Aber ist das eine Erzählung? Thomas Melle verdichtet. Komprimiert. Er beschreibt. Er berichtet. Und er kämpft mit dem Text um sich, um die Hoheit über die Narration seines Selbst, seines Lebens. Es geht um die Zurückeroberung seiner Geschichte
Ich bin zu einer Gestalt aus Gerüchten und Geschichten geworden. Jeder weiß etwas. Sie haben es mitbekommen, sie geben wahre oder falsche Details weiter, und wer noch nichts gehört hat, dem wird es hinter vorgehaltener Hand kurz nachgereicht.
»Etwas stimmt nicht.«
1999 als vierundzwanzigjähriger Student lebt Melle in einer WG. Einer der Mitbewohner bringt es auf den Punkt: »Etwas stimmt nicht.«
Melle erlebt seine erste manische Phase. Sie dauert drei Monate, gefolgt von schweren Depressionen.
Es folgen noch zwei weitere 2006 und 2010, die deutlich länger, bis zu anderthalb Jahren, dauern. Und sowohl ihre manisch, psychotisch, paranoiden Phasen als auch die depressiven Perioden sind erheblich heftiger. Insgesamt verbringt er sechs Jahre in diesen Zuständen.
Und danach?
Da versucht er sein Leben, von dem er nicht mehr weiß, wie es eigentlich aussah, oder in Zukunft aussehen könnte, wiederzufinden. Er hat keine Vertrauen mehr. Welcher Stimme kann er glauben?
Der Geheilte hat in sich einen, ich schrieb es schon, auf den er nicht bauen kann, und nicht nur einen, nein, viele, ein ganzes Heer aus unsicheren Kantonisten und ewigen Deserteuren. Und wenn er sich ganz ehrlich ins Gesicht blickt, ohne Verdrängung und Verstellung, in diesen ungeputzten, versifften Spiegel, dann ist sein Leben, so wie er es sich vorstellte, vertan, verpfuscht und nicht mehr auffindbar. Und ein anderes ist noch lange nicht in Sicht.
Und auch sein, wie soll man das sagen – Umfeld – traut ihm nicht mehr. Erkennt ihn nicht mehr. Da ist dann Schluss mit selbst auferlegter Empathie. Denn wenn wir näher herankommen, wirklich dicht herankommen, eye in eye, ist das wohlwollende, politisch korrekte, hilfsbereite Verständnis, das wir so gerne vor uns hertragen, schnell verbraucht. Menschen in psychotischen Phasen nerven. Ende! Sie mögen in diesen Phasen hellsichtige Erkenntnisse haben, ein wirklich dermaßen geschärftes Bewussstsein, dass wir es damit nicht aufnehmen können. Aber wir haben keine Tools mehr, das zu kanalisieren, es irgendwie zu integrieren. Wir haben längst keinen Platz und auch keine Antennen mehr für Schamanen, Derwische, Seher und Heiler oder eben Psychotiker.
Melle verliert alles. Alles! Nein vielmehr als alles, er gerät schwer ins Minus. Er verliert nicht nur seinen Verlag (Er darf sich der Suhrkamp Verlegerin Unseld-Berkéwicz nicht mehr nähern auf soundsoviel Meter), sondern auch seine loyalsten Freunde. Sie können einfach nicht mehr, halten ihn nicht mehr aus.
Allein sein Agent bleibt an seiner Seite. Eine für mich sehr berührende, fast übermenschlich-märchenhafte Figur.
Melle muss sich aushalten.
Erleben und erzählen
Und er muss – wie jeder Mensch – dem, was er erlebt, was sich um ihn herum ereignet, sofort eine Bedeutung geben. In unseren Hirnen beeinflussen sich sensorische und narrative Hirnregionen gegenseitig. Jedem Ereignis, Erlebnis wird eine Bedeutung zugewiesen. Natürlich ändern sich die Bedeutungen, die man Erlebnissen gibt im Laufe der Zeit. Aus zeitlichem Abstand und mit neuen Erfahrungen sieht etwas vielleicht ganz anders aus als im Moment des Erlebens.
Der erste Kuss wird im Nachhinein anders wahrgenommen, je nachdem, ob er der Auftakt zu einer andauernden Liebe fürs Leben, einer kurzen heftige Affäre oder eine lebenslangen Beziehunghölle war. Außerdem nehmen zwei Menschen, die gleiche Situation oft sehr unterschiedlich wahr, geben ihr unterschiedliche Bedeutung.
Bei Melle geht das weit darüberhinaus. Er gibt vergangenen Erlebnissen, Ereignissen, Handlungen, Überlegungen nicht nur eine neue Bedeutung, sondern die Bedeutung reißt komplett ab. Verschwindet. Alles wird zu einem einzigen großen, bedeutungslosen Schwachsinn. Auch in all seiner Scharfsichtigkeit.
Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat Ihre Vergangenheit zerschossen, und in noch stärkerem Maße bedroht sie Ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird Ihr Leben, wie Sie es kannten, weiter verunmöglicht. Die Person, die Sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich Ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Und Sie wissen nicht mehr, wer Sie waren.
Erzählen und schreiben
Und hier kommt wieder das Schreiben ins Spiel. Das Erzählen.
Thomas Melle gelingt es, durch das Schreiben eine Kontinuität herzustellen. Und zwar durch das Erzählen. Nicht durch Analyse, nicht durch Ursachenforschung, nicht dadurch, zu versuchen Begründungen und Bedeutungen zu finden. Denn hält man Ursachen ins Licht, werden sie durchsichtig und fadenscheinig.
Was davon Ursache ist, was Folge und was von der Krankheit nicht betroffener Umstand, ist letztgültig nicht festzustellen. Also muss ich erzählen, um es begreifbarer zu machen.
Muss die Ursachen, wenn sie schon nicht abbildbar sind, durch exakte Beschreibung der Unfälle emergieren lassen.
Durch brillantes, offenes, kompimiertes, verdichtetes, ungeschütztes Erzählen. Es geht darum – zumindest die Illusion – eines kontinuierlichen verlässlichen Selbst wieder herzustellen, das wir alle so nötig brauchen. Und es gelingt ihm, weil er eben doch nicht alles verloren hat. Nicht seine scharfsichtige Beobachtungsgabe, nicht seine Fähigkeit, präzise und poetisch zugleich zu formulieren, nicht seine schriftstellerische Gestaltungskraft.
Und damit erobert er sich die Hoheit über seine eigene Geschichte zurück.

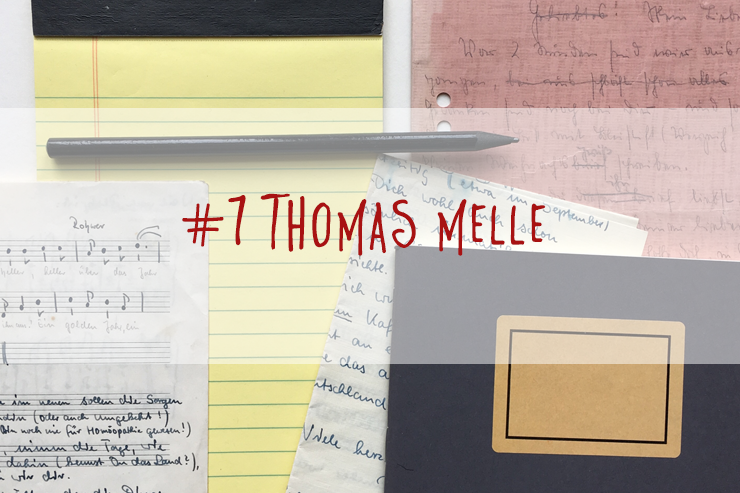

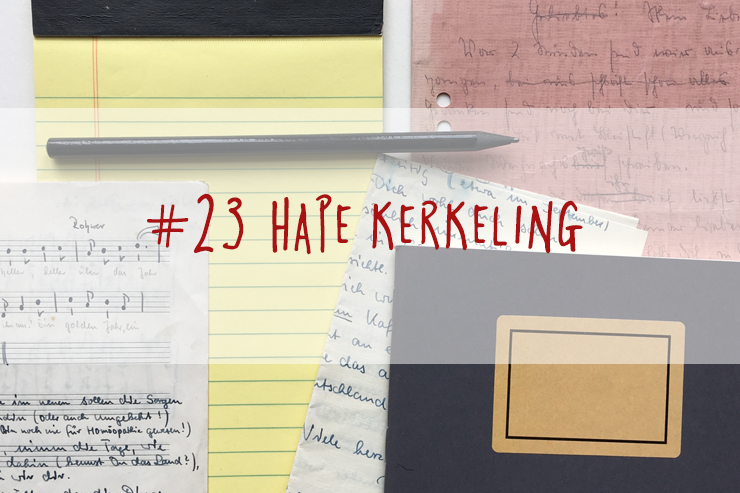
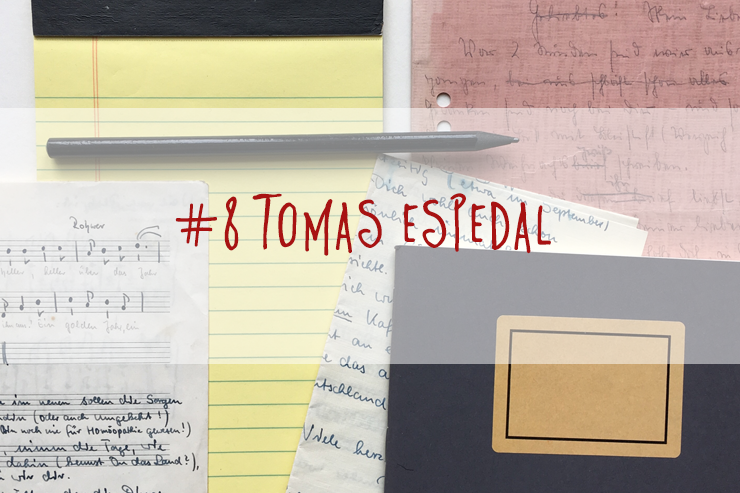

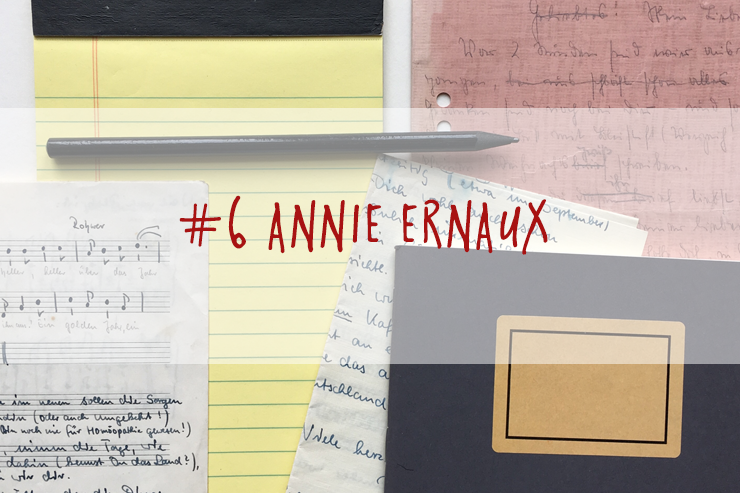
5 Comments