Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#2 Inner Child
— 2018
—Wie jetzt? Jetzt sofort?
Wir sitzen gerade beim Frühstück. Croissants leuchten in der Sonne auf dem runden Tisch in der Küche. Es ist ein herrlicher Morgen.
—Ja, warum nicht? Stell dir einfach vor, du besuchst dich als du ein kleines Kind warst?
—Das kann ich nicht so einfach. Mein Inner Child aufsuchen?
—Klar kannst du das. Mach die Augen zu und stell dir einfach vor, du besuchst dich, als du ein kleines Kind warst? Wo warst du da?
Und dann rasen die Bilder:
— 1960
Ein Musikschrank, Schiebetüren, dahinter ein Fernseher, oben unter einer Klappe versenkt, der Plattenspieler, gelbes Radiolicht, Bruchstücke aus der alten Wohnung. Es ist niemand da. In der Küche, der schmalen Küche, steht unter dem dunklen Fenster eine weiße Truhe, aufgedruckte Disneyzwerge, meine Spielzeugtruhe. Ich erkenne sie sofort. Dort sitze ich auf dem Boden, im Schlafanzug, in Windeln, räume Spielzeug ein. Ich sehe von irgendwo oben mich selbst, sehe dem Kleinen zu und ratsche schnell mit dem Daumennagel über die Truhe. Ja wirklich sie ist es, feingeriffelt, wie immer.
Neues Bild.
— 1958
Ich warte. Es ist stickig. Ich bekomme kaum Luft. Wonach riecht es hier? Ich kenne den Geruch. Was ist das? Wo ist die Tür? Warum ist es so dunkel? Rollläden. Gibt es eine Tür? Ich mache eine Tür auf. Es ist Nacht. Das Schlafzimmer, ja, das ist das Schlafzimmer. Schleiflackmöbel, dunkel ein Ehebett. Wo ist mein Bett? Das Bett des kleinen ich. Ich sehe mich selbst ankommen, aus dem Nichts, stehe jetzt mit dem Rücken zum Schrank. Ich bin viel jünger als jetzt. Vielleicht fünfundzwanzig.
Da ist der Vater er trägt ein Baby auf dem Arm. Mich. Noch jünger, als gerade in der Küche. Krank, Husten, Weinen. Der Vater trägt das Kind herum, versucht, es zu beruhigen. Versucht, versucht. Versucht! Aber er muss zur Arbeit. Müsste eigentlich längst schlafen. Wird morgen nicht ausgeschlafen sein. Versucht sein Bestes. Läuft mit dem Kind auf dem Arm um das Ehebett, das fast den ganzen Raum einnimmt. Gibt es kein Kinderbett? Keinen Platz für das Kind, für mich. Der Vater versteht nicht, was mit dem Kind los ist. Versteht nicht, warum seine geliebte Frau, nicht zur Stelle ist, warum sie nicht zu gebrauchen ist. Warum nimmt sie ihm nicht das Baby ab? Für ein paar Stunden. Ein paar Stunden Schlaf. Schläft sie? Ist sie überhaupt da? Sie ist nicht zu sehen. Was hat er falsch gemacht, was ist mit ihr los? Er weiß es nicht. Was ist los? Wie soll das weitergehen? Er ist erschöpft. Das Kind weint auf seinem Arm. Es hustet. Ich sehe dem Vater vom Kleiderschrank aus zu, wie er weiter auf- und abgeht vor dem Ehebett, dem großen. Das Kind hustet, ich huste, er weint auf seinem Arm.
Ich löse mich vom Schrank, langsam, gehe auf den Vater zu, nehme ihm das Kind ab. Der Vater schaut mich überrascht an, erleichtert. Endlich ausruhen. Ich halte das Baby, halte mich auf dem Arm: Es ist gut, alles wird gut. Mein Herz schlägt ruhig und stark. Das Kind an meiner Brust. Sein Köpfchen an meiner Schulter. Komm, pssscht, ruhig, alles ist gut, du wirst ein tolles Leben haben. Es wird ruhig, hört auf zu weinen. Dann drehe ich mich um, weiß nicht, wo die Tür ist und geht durch den Schlafzimmerschrank, den riesigen Schleiflackkleiderschrank hinaus. Jetzt erkenne ich auch den Geruch. Mottenkugeln. Ich schiebe die Bügel auseinander mit dem Baby auf dem Arm. Es ist jetzt ruhig. Ich schaue es an, es schaut zurück, verwundert. Zwischen den Mänteln schaue ich mich noch einmal um.
Dort steht mein Vater, überrascht, erleichtert, traurig.
—Wenn du jetzt gehst, bin ich doch schon tot.
Ja das stimmt. Er stirbt ein paar Jahre bevor ich mich auf meine Inner-Child-Reise begebe. Bevor ich komme und ihm das weinende Baby abnehme.
— 2018
—… und wie fühlst du dich?
—Puh. Er hat gesagt, dann bin ich doch schon tot, wenn du jetzt kommst. Spooky. Ich war in der alten Wohnung, aber irgendwie war ich jünger als jetzt. Vielleicht so Mitte zwanzig. Als wäre ich da schon mal mit fünfundzwanzig/sechsundzwanzig oder so gewesen und hätte das jetzt nur nochmal wiedergesehen.
—Was war mit fünfundzwanzig?
—Keine Ahnung, die Räumung, Nasses Dreieck, da habe ich meinen sechsundzwanzigsten Geburtstag gefeiert.
—…und dir deine zerbröselnden Zähne mit einer Nagelfeile geschliffen, aus Angst vor dem Zahnarzt.
—Aber genau damals habe ich die Angst vor Zahnärzten verloren. Dem einen habe ich doch vor lauter Freude noch eine Zeichnung geschenkt. Embarassing Moment.
—Kannst du dich erinnern, ob du damals schonmal, so eine Inner-Child-Reise gemacht hast.
—Nicht das ich wüsste. Damals hatte ich bestimmt noch nie etwas davon gehört. Meinst du diese Ängste sind verschwunden, weil ich damals das kleine Kind, das kleine ich, besucht habe, beruhigt habe, irgendwie mitgenommen habe. Ihm gesagt habe, dass es keine Angst haben muss?
—Steile These
—Warum war ich ein so ängstliches Kind? Ich hatte wirklich Angst vor allem. Ständiger Alarm und wenn er losging: Panik. Ungezügelt. Vor Zügen, die in den Bahnhof einfahren, vor Schiffen, die ins Horn tuten, vor wirklich allen Tieren. Vor dem Zahnarzt, vor dem Impfen, vor den ständigen Spritzen, vor den — die wollen nur mal in deinen Mund schauen — Lederfesseln, mit denen ich vor den Äthernarkosen auf dem Stuhl fixiert wurde, überhaupt vor Ärzten. Ich traute niemandem. Vor allem nicht meiner Mutter. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass mir jemand die Wahrheit sagte, dass mich jemand beschützen würde, im Zweifelsfall auf meiner Seite wäre, mich oder meine Geheimnisse nicht verraten würde. Nur zu deinem Besten.

— 1961
Jetzt wird alles besser. Jetzt muss ich keine Angst mehr vor den Kühen haben, die mich davon abhalten, aus unserer kleinen Wohnung nach draußen zu gehen. Auf die Wiese hinters Haus, auf der ich rennen könnte, für mich alleine. Mit meinem Ball.
Aber es geht nicht. Es ist nicht besser. Die Kühe glotzen, glotzen mich an, fixieren mich, während ich auf dem Klodeckel stehe und durch das kleine Badfenster die Kuhweide beobachte. Um zu sehen, ob die Luft rein ist. Nein, ist sie nicht. Die Kühe sind da und starren mich an. Eine besonders, mustert mich. Wartet nur auf mich. Hat was gegen mich. Hat etwas vor. Etwas Gefährliches. Da ist es egal, dass sie hinter einem Zaun steht. Vermutlich ist es sogar ein Elektrozaun. Ich erinnere mich, das Wort schon Mal gehört zu haben. Elektrozaun. Aber ich weiß noch nicht so genau, was es bedeutet. Hört sich jedenfalls auch gefährlich an. Keine Chance, unbemerkt durch die Haustür zu kommen, schnell ums Haus zu rennen. Auf die rettende Wiese hinterm Haus. Bleibt nur durch den Keller und hinten raus. Durch den Keller – hallo? Also stehe ich da auf dem Klodeckel. Ich will rennen, aber ich kann nicht raus.
—Mama?
—…
—Mama? Wollen wir was spielen?
—
…
—Ich will gerne raus?
—…
—Mama? Bist du da?
Also gut, durch den Keller.
Treppe runter, links durch die Waschküche. Es hallt. Irgendwo klackert etwas. Hinter mir her. Weiter laufen. Hoffentlich geht die Tür sofort auf. Die Tür nach draußen. Ja. Jetzt noch die Treppe hoch in den Hof. Jetzt nicht umsehen, bevor die Tür zufällt. Die Tür fällt zu. Aber auch jetzt, immer noch nicht umsehen. Ist etwas mit mir raus? Nein. Endlich oben.
Eine neue Gefahr. Die beiden Mädchen von nebenan. Zwei, drei Jahre älter. Zwei, drei Jahre machen viel aus, wenn man fünf ist. Auch vor denen habe ich Angst, sie sind unberechenbar. Ich weiß nie, ob ich mitmachen darf oder nicht. Ich bleibe mit meinem Ball lieber am Rand der Wiese. Halte in lieber in der Hand.
—Geh einfach nach vorne, spiel da. Kühe tun doch nichts.
Kühe sind definitiv gefährlicher als Mädchen. Unberechenbarer, in ihrer Ruhe, ihrem unendlichen Wissen, ihrem schwarzen Kuhaugenblick. Ich bleibe da. Kicke den Ball vor mir her, gegen die Wand.
—Hör auf damit.
Dann plötzlich darf ich doch mitspielen, mache mich nützlich. Bin richtig gut und schneide die Faltenröcke ihrer Ausschneidepuppen ordentlich grade. So gut es geht. Nicht gut. Wenn man genau hinsieht, erkennt man noch immer die Narben ihre wütenden Bisse an meinem Oberarm.

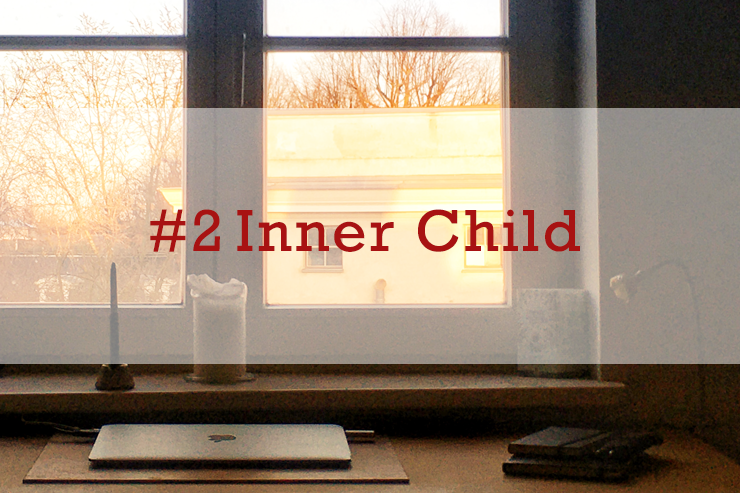
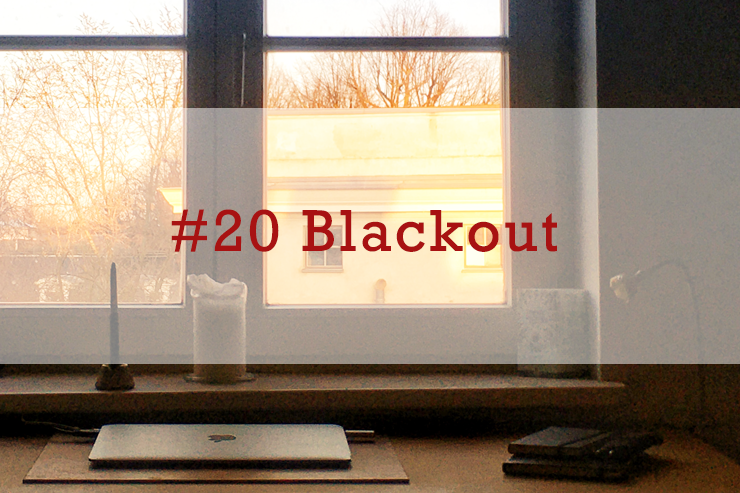
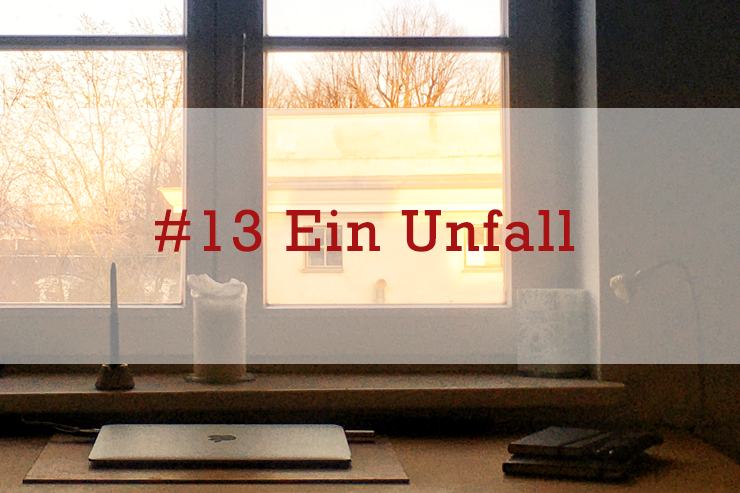
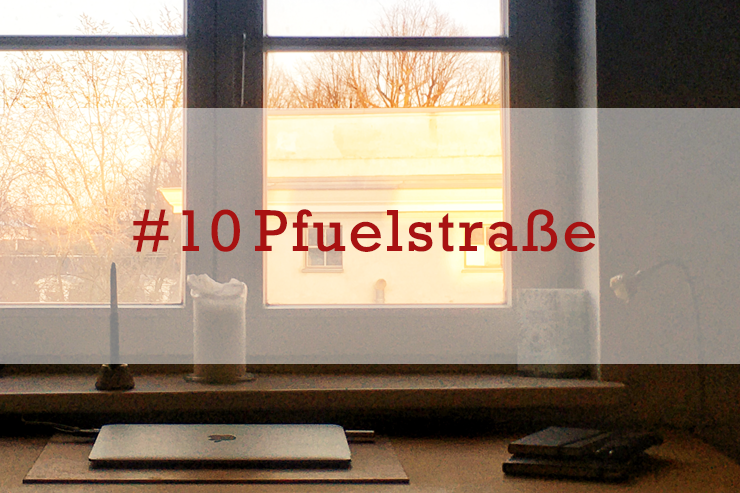


18 Comments