Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#3 Verluste
— 1978
Sie ist knapp ein Jahr jünger als ich.
Ist ein Jahr nach mir auf die Kunstakademie gekommen. Wir sind locker befreundet, beide bei der gleichen Professorin – und wir sind beide aus Wattenscheid. Sie ist es, die mir den Namen anhängt. Uwe Wattenscheid. Bescheuert.
Sie findet bescheuert, dass ich meine Arbeiten nicht wenigstens fotografiere, bevor ich sie zerstöre. Dabei zerstöre ich sie meist gar nicht. Sie zerfallen von allein. Oder stehen im Weg rum und werden dann von mir entsorgt. Mit der Sackkarre in den Container bei den Steinbildhauern im Akademiehof bugsiert.
Warum fotografiere ich sie nicht? Vieles was fertig ist, interessiert mich dann nicht mehr.Verluste
Die riesige Gipsskulptur, zum Beispiel. Es gibt kein Foto von ihr. Warum auch. Sie ist nicht mal geworden, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich lasse mich selbst komplett abgießen, im Stehen, in der verbogenen Haltung desjenigen, der im Stahlwerk die Gusspfanne mit einer Tonne weißblubbernder 1.300° heißer Stahlsuppe an den Kranhaken hängt. Der ganze Körper will weg. Der Arm muß aber nah ran, um den Haken einzuhängen, den der Kranfahrer möglichst genau herablässt und dann wieder hochzieht, möglichst ohne zu rucken, damit es nicht schlabbert. Ich versuche, diese Haltung in der Stuckwerkstatt einzunehmen. Zu halten. Während der Meister und seine Gehilfen mich mit Gips zukleistern. Immer abwechselnd eine dicke Schicht Gips und dann eine Schicht Jute zur Stabilisation. Von den beiden Strohhalmen, durch die ich atme, rutscht einer ziemlich schnell aus dem Nasenloch, als der Gips auch über mein Gesicht gespachtelt wird. Nerven behalten. Weiter atmen. Durch ein Nasenloch. Geht.
Fertig. Jetzt noch abwarten, bis der Gips fest wird. Ich höre durch den Gips gedämpft, wie sie beginnen, aufzuräumen. Der Gips wird nicht nur allmählich warm beim Trocknen, sondern auch verdammt schwer. Und ich merke, wie ich beginne umzukippen, gaaaanz langsam. Nach hinten. Unfähig mich zu bewegen, unfähig zu rufen. Eingegipst eben. Die gesamte Vorderseite, die Arme und der Kopf. Bevor ich aufschlage, womöglich auf die Werkbank hinter mir, bemerkt es jemand. Zwei Leute fangen mich auf. Danke. Der Meister klemmt mir ein Kantholz unter das Schulterblatt, fixiert es am Boden. Noch gefühlte zehn Minuten, dann ist der Gips hart. Durchhalten. Sie reden mit gut zu. Amüsiert. Ich versuche, meine Finger zu bewegen, die Arme. Sie lösen sich etwas aus der jetzt harten Gipsschale. Alle helfen. Halten den Gips, entfernen das Kantholz, ziehen mich nach hinten raus aus der Schale.
Ohne mich steht der Gips frei. Stabil. Innen, da wo ich war, sieht er sehr organisch aus, aber ich erkenne keinen menschlichen Körper in dem negativen Abdruck. Außen haben sie ihn mit Händen und Kellen grob geglättet. Der Kontrast ist natürlich noch nicht groß genug. Und die Haltung? Erkennt man, was ich meine? Das Sich-hindrehen-müssen und das gleichzeitige Weit-weg-wollen. Den Widerspruch in der Bewegung? Erkennt man ihn. Ich erkenne ihn nicht.
— Einer von euch vielleicht?
— Puh. Naja.
— Muss du vielleicht noch mehr rausarbeiten.
— Ja muss ich wohl. Ich geb einen aus im Füchschen für euren Einsatz.
Starker skulpturaler Wortschatz
So heißt es. Aber ich weiß, dass ich gescheitert bin. Trotzdem schleife, rasple, gipse ich noch tagelang, wochenlang an dem Ding rum. Es wird nichts.
Viele, die das Ding sehen, finden es großartig. Sehen die organische Innenseite, das Weiche, Zarte, in der glatten harten Schale außen. Müsste mir doch was sagen, Sternzeichen Krebs. Tut es aber nicht. Darauf kommt es mir nicht an. Ich will eine Figur machen, die irgendwohin muss, und gleichzeitig weg will. Nicht Weicher Kern und Harter Schale durchdeklinieren.
Ich weiß noch nichts von der Eigenständigkeit der Skulpturen, vom bildhauerischen Prozess. Vom Hinschauen, vom Innehalten, vom Beobachten-was-passiert, von der Kommunikation zwischen Künstler und Werk, in dem das Werk immer recht hat. Hier gilt immer noch, was ich will. Von wegen Dein Wille geschehe.
Aber zerstören will ich es auch nicht. Das Ding. Schaff ich nicht. Ist mir unangenehm, weil mir so viele geholfen haben. Weil so viel Material draufgegangen ist. Irgendwann erlöst mich der Stukkateur, kommt zu mir, weil ihm das Ding die Werkstatt zustellt.
— Okay, ich hole sie ins Atelier.
Zwei Leute helfen mir beim Transport über den langen Flur der Akademie. Unterwegs wird mir klar, wie sinnlos das ist. Wir biegen ab auf den Hof, weg mit dem Ding. In den Container. Missglückte Figur im Container. Vielleicht die stärkere Arbeit.
Trotzdem lass ich an dem Tag den Modellierbock mitgehen, wer weiß, wozu der noch gut sein wird.
Mit der Kunst zu leben ist nicht einfach, ohne auch nicht
In der Klasse hockt sie auf dem Boden. Vor sich ausgebreitet liegen Zeichnungen. Schwarz-weiß, Gesichter, Figuren, Frauenbilder. Nicht sehr elaboriert gezeichnet, rough, sagt man noch nicht, kraftvoll, obwohl sie so klein sind, die Bilder. Durch das große Rundbogenfenster kommt das Licht von Osten, hell aber nicht grell, keine direkte Sonne. Trotzdem muss sie viel hin und herschieben, damit die Fenstersprossen keine Schatten auf die Bilder werfen. Sie gibt sich Mühe, gute Fotos zu machen. Kommt mir überflüssig vor. Sie hat doch die Bilder. Ich denke nie ans präsentieren. Kataloge. Portfolios. Dokumentationen. Du hättest das Ding wenigstens fotografieren sollen, einmal durchfotografieren, flüstert mein schlechtes Gewissen. Sie schaut hoch. Der Fotoapparat mit Spuren von Gipsstaub.
— Du hättest das Ding wenigstens fotografieren sollen, einmal durchfotografieren.
— Wozu?
Sie hat sich solche Mühe gegeben. Sie hält noch vierzig Jahre durch. Dann bringt sie sich um.Verluste, Verluste Verluste

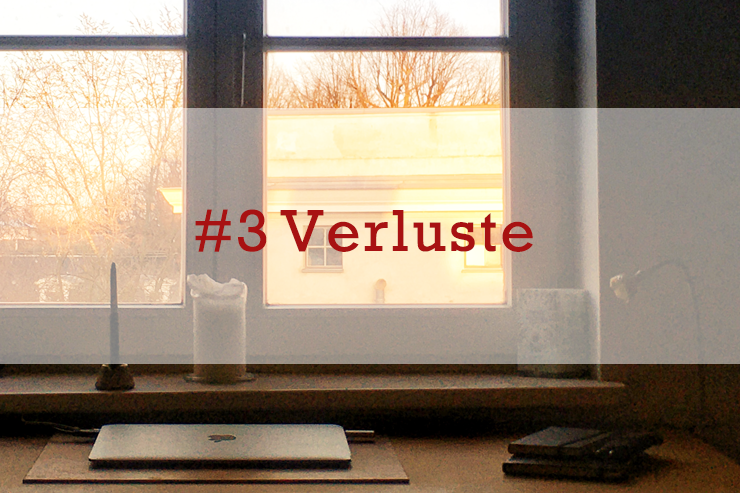

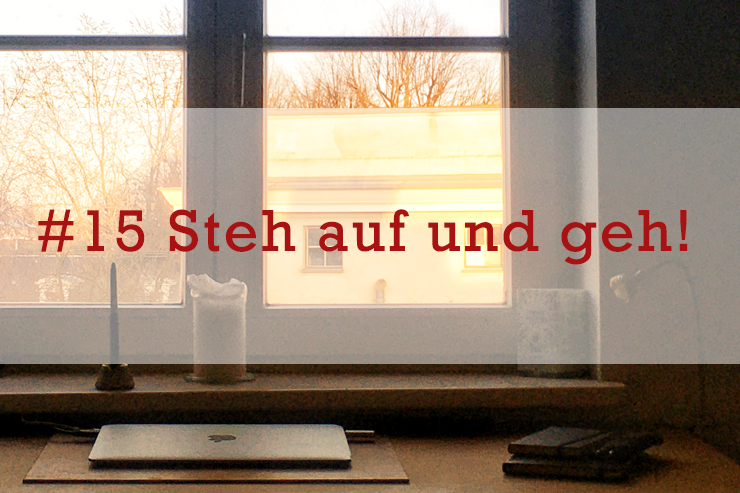



17 Comments